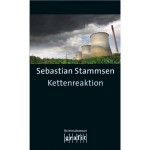Liebe und Staatsbankrott: „Lustige Witwe“ ist nicht so lustig

Valencienne (Dorothea Brandt) geht mit ihrem Mann Mirko (Miljan Milović) nicht immer so pfleglich um … Foto: Andreas Fischer
Franz Lehárs „Lustige Witwe“ begeistert mit musikalischer Qualität und dramaturgischem Pfiff. Irgendwie scheint sie aber auch in unsere Zeit zu passen. Denn momentan wird zwischen Lübeck und Innsbruck auf mehr als ein Dutzend Bühnen versucht, der Dame ihre Millionen abzuluchsen. Allein in NRW intrigiert die pontevedrinische Diplomatie an vier Orten: ab Dezember in Düsseldorf, in Detmold ab 4. November in der Neuinszenierung von Holger Potocki und ab Silvester geht man in Dortmund an der Hand von Regisseur Matthias Davids ins Maxim. Im Barmer Opernhaus hatte Lehárs sensationelle Erfolgsoperette von 1905 am Samstag, 15. Oktober, ihre zweite Premiere – die erste fand schon im Juni in Solingen statt.
Gar so lustig, wie der Titel glauben machen will, ist diese „Witwe“ aber nicht: Es geht zwar ums erotische Vergnügen, um Grisetten und Seitensprung, aber vor allem ums Geld. Zwanzig Millionen ist Hanna Glawari wert. Eine begehrte Beute für die Pariser Lebewelt. „Die Millionen sind angekommen“, kündigt einer der Pariser Filous ihre Ankunft an: Damit ist alles gesagt. Charme, Intelligenz, Selbstbewusstsein, selbst Schönheit und Ausstrahlung? Egal. Hauptsache, die Frau ist millionenfach vergoldet.
Derweil plagen den pontevedrinischen Gesandten (im Rollstuhl, aber bei den „Weibern“ gut zu Fuß: Miljan Milović) lastende Sorgen: Wird das Geld der Frau Glawari aus seinem Vaterlande abgezogen, droht der Staatsbankrott. Abhilfe muss Graf Danilo schaffen. Der zeigt sich jedoch wenig patriotisch und lehnt den erotischen Staatseinsatz rundweg ab. Die Tanzmädels sind ihm lieber …
Pascale-Sabine Chevroton weiß um die gesellschaftlichen Untiefen in diesem Stück. Und inszeniert die „Lustige Witwe“ in dieser Koproduktion mit den „Folies lyriques“ in Montpellier weit weg von der üblichen Operettenästhetik. Weder Bühnenbild noch Kostüme (Tanja Liebermann) schwelgen in Frack und Tutu. In der Botschaft des Beinah-Bankrott-Staates sind Wände rissig und Stuckleisten geborsten. Für Madame Glawaris Heim ersinnt Bühnenbildner Jürgen Kirner eine gewaltige Handtasche. Es könnte auch ein Geldbeutel sein, der sich öffnet und wie aus einem roten Rachen die leichtlebige Festgesellschaft ausspuckt. Die Damen vom Maxim sehen aus wie Buchhalterinnen. Auch das passt: eher Dienerinnen des Geldes als des Eros. Dass Esprit und Humor gestutzt werden, scheint kalkuliert. Hans Richter als Komiker Njegus darf zwar wienern, aber die üblichen Stegreifsprüche sind ihm nicht erlaubt. So bleibt diese kommentierende Figur profillos. Chevrotons Lesart nimmt die Operette und ihr Sentiment ernst, aber die Szene moussiert nicht. Stellenweise glaubt man, Lehár habe ein Kammerspiel von Ibsen vertont.
Im Orchester sieht das zum Glück anders aus. Florian Frannek entschlackt die Partitur, gibt ihr kammermusikalische Finesse, welche die Orchester-Solisten der Wuppertaler Sinfoniker bereitwillig erfüllen. Der Dirigent „champagnerisiert“ den Rhythmus. Er gibt den schmeichelnden Melodien ohne schmierige Agogik Raum. Die Geigen flüstern wirklich „hab‘ mich lieb“ in feinstem, wenn auch nicht in süffigem Pianissimo der geforderten großen Besetzung. Und das Studium der Noten ist im Graben mindestens so eifrig betrieben worden wie auf den Brettern das Studium der Weiber.

„Lippen schweigen, s’flüstern Geigen …“: Hanna Glawari (Susanne Geb) und Danilo (Kay Stiefermann).Foto Andreas Fischer
Dorothea Brandt ist eine nahezu perfekte Tanzsoubrette; ihre Valencienne hat Format. Susanne Geb zeigt die selbstbewussten Seiten der Hanna Glawari. Doch ihrem soliden, zu strahlendem Ton fähigen Sopran fehlt schmeichelnde Weichheit; die lyrische Bezauberung kleidet sie eher in Silber als in Samt. Kay Stiefermann – der Wuppertaler „Holländer“ – erweist sich als wandlungsfähiger Darsteller und routinierter Sänger: Trotz Krankheit singt er den Danilo respektabel und rhetorisch reflektiert. Boris Leisenheimer als Camille de Rosillon scheitert ob der verfehlten Position seines Tenors an den Anforderungen der Partie. Seine Tongebung wirkt gequält, die Höhen sind trocken forciert. Tomas Kwiatkowski und Nathan Northrup sind als Cascada und Saint-Brioche richtige Klischee-Pariser mit Baskenmütze und Halstuch. Der Chor ist von Jens Bingert zuverlässig einstudiert.
Im Programmheft liest man mit Erstaunen, wie oft die Bankrott-Kandidaten unter den europäischen Staaten schon zahlungsunfähig waren – an Pontevedro ist dieses Schicksal noch einmal vorübergegangen. Die Botschaft ist angekommen: reicher Beifall.