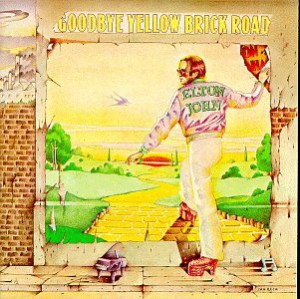„Gottschalk live“: Onkel Thommy plaudert brav und voller Selbstmitleid

Gottschalk in seinem Element, vor Publikum 2005 zur Eröffnung einer Haribo-Ausstellung in Koblenz. Foto: Weinandt
Einer muss es ja schließlich tun. Sich todesmutig hinabstürzen ins öffentlich-rechtliche Vorabendprogramm. Die Courage besitzen, einem Giganten der Fernsehunterhaltung etwa 25 Minuten lang Aug’ und Ohr zu leihen. Also tapfer sein und Thomas Gottschalk gucken. Kritiker, Du gehst einen schweren Gang. Muss es sein? Es muss sein!
Und ach: So groß ist die Hemmschwelle nun wieder nicht. Wir sitzen im Wohnzimmer, der Entertainer auch. Ein lieber Onkel, der da zu uns spricht. Er gibt sich familiär und artig, redet in moderatem Tonfall. Nun liebe Kinder (und Erwachsene), gebt fein acht… Was er uns kredenzt, ist indes der Beachtung wenig wert: schale Gags, selbstmitleidige Reminiszenzen an seinen größten Erfolg namens „Wetten, dass..?“ und nach wie vor das unterschwellige, gleichwohl subtile Betteln um Zuschauer.
„Gottschalk live“ heißt dieses neue ARD-Format. Es kommt nicht an, die Einschaltquoten purzeln ins gefühlte Nirvana. Vielleicht, weil sich der Moderator selbst im Weg steht. Steif wirkt er, wie ein sedierter Harald Schmidt. Gut, ihn begleitet weder eine Live-Band noch kann er sich vor Studiopublikum austoben. Zugegeben, im Verhältnis zu „Wetten, dass..?“, hat er nur eine Minute Zeit. Aber warum dann nicht in Würde aufhören, statt sich ins Korsett der kurzen Dauer zu zwingen?
An diesem Montag ist Helge Schneider zu Gast. Der sieht seltsam zivilisiert aus, richtet sich in Gottschalks behaglicher Stube brav ein. Man plaudert, und dann darf Schneider, der vorzügliche Jazzpianist, dem Flügel im Hintergrund sanfte Klänge entlocken. Währenddessen erzählt Katherine Heigl, amerikanische Schauspielerin deutsch-irischer Abstammung (bekannt durch die Krankenhaus-Serie „Grace Anatomy“), wie sie sich auf die Spuren ihres Großvaters in Esslingen gemacht hat. Dass Gottschalk dabei der Simultanübersetzerin allzuoft ins Wort fällt, ist ein ärgerlicher Schönheitsfehler.
So plätschert der Vorabend dahin. Die Lider werden schwer. War noch was? Ach ja, ein Berliner Würstchenverkäufer, der seinen Grill am Fahrradlenker befestigt hat, bringt „Würstchen für die Würstchen“ (Originalton Gottschalk, haha) ins Studio. Und ganz zu Beginn der Sendung stimmt uns eine Haribo-Reklame ein – nur froh werden wir nicht. Dirty Harry, übernehmen Sie!