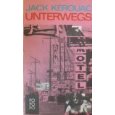Meilensteine der Popmusik (5): Jim Croce
Was hatten sie schon gebracht, die 60er? Hatten sie die Welt verändert, diese Handvoll Protestsongs, die blumigen Parolen, wie z.B. „make love not war“? Alles tauchte irgendwann unter in den großen Drogensumpf. Und der Krieg ging erst einmal weiter. Die Vereinigten Staaten von Amerika verschleuderten 135 Milliarden Dollar für diesen sinnlosen Krieg. Viel schlimmer noch, 3 Millionen Kriegsopfer, darunter 56.000 tote GIs, waren die bedrückende Bilanz eines Horror-Trips in Vietnam. Wer wollte in diesen Tagen schon die Lieder der Heimat hören? Die Songs, die den Geist der Gründerzeit beschworen – die erzählten von den unbegrenzten Weiten des Landes, den unbegrenzten Abenteuern, den unbegrenzten Möglichkeiten seinen Mann zu stehen, der unbegrenzten Liebe zur Heimat. Die Geduld der Nation hatte Grenzen, Anfang der 70er Jahre. Jim Croce aus Pennsylvania bekam sie zu spüren, diese vorerst letzte, große Depression.
Er war ein einfacher Mensch vom Land, der die Dinge nahm, wie sie kamen. Und mit 18 kam erst einmal die erste Gitarre auf ihn zu, sogar eine 12-saitige. Ein paar Jahre später spielte er schon ganz passabel, und nebenbei hatte er schon so viele Berufe ausgeübt, dass er damit ein ganzes Arbeitsamt hätte beschäftigen können: Trucker, Autowäscher, im Steinbruch Steine kloppen, um sich herum erkannte er nur Proletarier. Danach vermittelte er kleinen Radiostationen Werbespots, und wenn Not am Mann war sprang er auch mal selbst ein. Über dieses wahrhaftige und doch so andere Amerika konnte Jim Croce wunderschöne Lieder schreiben, fast schon moderne Folklore, die aber keiner hören wollte. Immer wieder versuchte Jim Croce, seine Songs an den Mann zu bringen. Er zog sogar in die von ihm so ungeliebte Metropole New York, tingelte durch die Clubs, um dann wieder frustriert, gänzlich ohne Selbstvertrauen, aufs Land zurück zu ziehen. Kurz bevor der schnauzbärtige Jim Croce die Brocken endgültig hinwerfen wollte, kam doch noch ein Plattenvertrag zustande. „You don’t mess around with Jim“ hieß der trotzige Titel dieser LP, und die Kritiker überschlugen sich plötzlich. Auf einmal schien alles nur auf diese bodenständige Musik gewartet zu haben. Der Zeitgeist hatte mal wieder zugeschlagen, diesmal profitierte Croce davon. Seine Lieder aus der Welt der Arbeiter und Bauern, seine schlichten und auch melodiösen Liebeslieder, unterstützten ein gerade wieder neu entstehendes Selbstwertgefühl der Amerikaner. Jim Croce selbst blieb nur ein Jahr, um die Zeit als Superstar auszukosten. Am 20. September 1973 kam er bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Er war gerade 30 Jahre alt.
Heute kann man sagen, dass kaum ein anderer Künstler eine solch´ große Lücke in den USA hinterlassen hat. Auch wenn Superstars wie Paul Simon, Billy Joel oder auch Bruce Springsteen in den folgenden Jahren immer wieder versucht haben die amerikanische Identität neu zu definieren, die einfache Mentalität des Otto-Normal-Amerikaners aus den Weiten des mittleren Westens trafen am besten die schlichten Songs des Jim Croce. Mit seinen persönlichen Erfahrungen können sich auch heutzutage noch viele Amerikaner identifizieren: Der tägliche Arbeitskampf, der Trott, die Selbstzweifel, die Unfähigkeit Gefühle auszudrücken. Immer wieder wird der „amerikanische Traum“ von Jim Croce in Frage gestellt. Besonders am Beispiel der großen Metropole, am Stolz Ihrer Einwohner. Was bedeutet es schon, dieses ‚Big Apple‘ New York: „Namenlose Gesichter in der Nacht – die Straßen sind zwar voll, doch alles sieht so fremd aus. Ein Jahr habe ich hier gelebt und wurde nie heimisch. Ich dachte, hier groß rauszukommen. Furchtbar schnell musste ich viel lernen; aber es waren keine schönen Dinge, und es ist schon so lange her, dass ich mich einfach nur wohlfühlen konnte. All´ das ist der Grund, warum New York nie mein Zuhause sein wird“.
You don´t mess around with Jim – Jim Croce