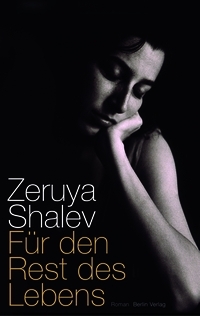Zwischen Landtagswahl und Fußballfesten: Das Propaganda-Dilemma
 Was würden die Menschen nur machen, wenn man ihnen die Rituale nehmen würde, wenn es keine Identifikationen gäbe mit dem Ort, wo man seine wertvolle Zeit verbringt und lebt? Was wäre die Welt ohne Massenbewegungen? Was wäre das Leben ohne Fußball und ohne Parlament? Wir brauchen Begeisterung und Bewunderung, Schimpf und Schande, Leid und Freude, besonders, wenn man ein Leben führt, das in einem Umfeld stattfindet, das nicht zu den paradiesischen gehört – im Ruhrgebiet. Derzeit befinden sich zum Beispiel in Dortmund die Plakate, Banner und sonstige weit sichtbare Werbung in einem engen Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit: Meisterfeier und Wahl zum nordrhein-westfälischen Parlament.
Was würden die Menschen nur machen, wenn man ihnen die Rituale nehmen würde, wenn es keine Identifikationen gäbe mit dem Ort, wo man seine wertvolle Zeit verbringt und lebt? Was wäre die Welt ohne Massenbewegungen? Was wäre das Leben ohne Fußball und ohne Parlament? Wir brauchen Begeisterung und Bewunderung, Schimpf und Schande, Leid und Freude, besonders, wenn man ein Leben führt, das in einem Umfeld stattfindet, das nicht zu den paradiesischen gehört – im Ruhrgebiet. Derzeit befinden sich zum Beispiel in Dortmund die Plakate, Banner und sonstige weit sichtbare Werbung in einem engen Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit: Meisterfeier und Wahl zum nordrhein-westfälischen Parlament.
 An der Wand des Hauses, in dem ich wohne, hängt ein Banner zum Ruhm des ehrenwerten Ballsportvereins Borussia Dortmund, dargebracht durch ansässige Firmen, die ihre Wärme zum hiesigen Verein demonstrieren wollen. Warum nicht? Auch der Liverpooler, der Manchester, der Römer, der Madrilene, sie alle identifizieren sich mit ihrem Heimatverein. Da sieht man Fußballbrötchen und Meisterwürste, kleine, gelbe Herzen und T-Shirts, die die Liebe aus dem Bauch bedecken. Und dazwischen stehen und hängen die Wahlplakate und – je nach Zuneigung – frohlockt der Genosse und sein Wähler.
An der Wand des Hauses, in dem ich wohne, hängt ein Banner zum Ruhm des ehrenwerten Ballsportvereins Borussia Dortmund, dargebracht durch ansässige Firmen, die ihre Wärme zum hiesigen Verein demonstrieren wollen. Warum nicht? Auch der Liverpooler, der Manchester, der Römer, der Madrilene, sie alle identifizieren sich mit ihrem Heimatverein. Da sieht man Fußballbrötchen und Meisterwürste, kleine, gelbe Herzen und T-Shirts, die die Liebe aus dem Bauch bedecken. Und dazwischen stehen und hängen die Wahlplakate und – je nach Zuneigung – frohlockt der Genosse und sein Wähler.
Die Parteien sind vom Wähler abhängig, sowie der Wähler letztendlich von den Parteien abhängig ist. Und wer abhängig ist, flucht gern und entzieht sich dem Gedanken, sich der Abhängigkeit zu entledigen. Immerhin kann man sich mehr oder weniger aussuchen, von wem man denn abhängig sein will. Das gilt auch für den Fußballer und seine Fans, die ja im Falle einer Meisterschaft kurzfristig zu einer großen Masse anschwellen. Da will jeder mal den Lewandowski oder den Hummels anhimmeln. „Unsere Jungs“, heißt es dann. Es gibt ganze Städte, ja, Regionen, die vom Fußball abhängig sind. Er ist das Aushängeschild und das Tor zur Welt. Das gilt mindestens für Dortmund und erst recht für Gelsenkirchen (dort gibt es den Verein Schalke 04). Wir lassen uns auf die Abhängigkeit ein, oft mangels Alternativen.
 Wenn man jedoch ein griesgrämiger Zeitgenosse ist, dann wird der Fall schwierig, denn für ihn oder sie ist das Propaganda. Er fühlt sich überdeckt von all den gleichen Meinungen und Feierstimmungen, seien es die des ungeliebten Fußballvereins, oder die der ungeliebten Partei. Das geht zu weit. Man solle ihn in Frieden lassen mit diesen Massenverehrungen, erste recht wenn er, wie in einem angenommenen Fall, einer anderen Partei zuneigt als der, die gerade feiert, oder wenn die Mannschaft, zu der er neigt, eine andere ist, zum Beispiel die aus Gelsenkirchen. Aber bei einem Bierchen und mehr kann er darüber nachsinnen, wenn es denn mal anders kommt, wenn seine Partei und erst recht seine Mannschaft die Liebesbekundungen ganzer Regionen zu spüren bekommt. Dann ist er Teil des Ganzen und freut sich gnaden- und rücksichtslos nur über seine Freude. Da schlägt die monogame Identifikation durch, wie jetzt für alle anderen in dieser Stadt, wo an jenem Haus, in dem er wohnt, ein Banner mit Liebeserklärungen das Leben verklärt.
Wenn man jedoch ein griesgrämiger Zeitgenosse ist, dann wird der Fall schwierig, denn für ihn oder sie ist das Propaganda. Er fühlt sich überdeckt von all den gleichen Meinungen und Feierstimmungen, seien es die des ungeliebten Fußballvereins, oder die der ungeliebten Partei. Das geht zu weit. Man solle ihn in Frieden lassen mit diesen Massenverehrungen, erste recht wenn er, wie in einem angenommenen Fall, einer anderen Partei zuneigt als der, die gerade feiert, oder wenn die Mannschaft, zu der er neigt, eine andere ist, zum Beispiel die aus Gelsenkirchen. Aber bei einem Bierchen und mehr kann er darüber nachsinnen, wenn es denn mal anders kommt, wenn seine Partei und erst recht seine Mannschaft die Liebesbekundungen ganzer Regionen zu spüren bekommt. Dann ist er Teil des Ganzen und freut sich gnaden- und rücksichtslos nur über seine Freude. Da schlägt die monogame Identifikation durch, wie jetzt für alle anderen in dieser Stadt, wo an jenem Haus, in dem er wohnt, ein Banner mit Liebeserklärungen das Leben verklärt.