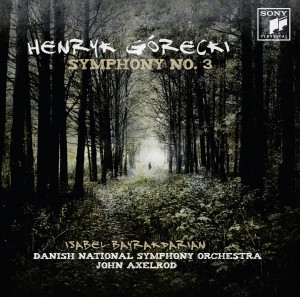„Kindheiten“ oder: Die untröstliche Heiterkeit des Jean-Jacques Sempé
Nein, eine schöne Kindheit hat er nicht gehabt: Vor den allzeit lautstarken Streits der Eltern flüchtete er, wenn er konnte, zum Radio und wob sich eine Phantasiewelt aus dem Gehörten. Wurden Mutter und Stiefvater zwischendurch auf ihn aufmerksam, dann hagelte es meistens Ohrfeigen. Mindestens.
Wir reden von Sempé. Jean-Jacques Sempé. Wer seine wunderbaren Zeichnungen kennt, weiß, dass wohl kaum jemand sich den Duft und Hauch der trotz allem unbeschwerten, stets zu Streichen aufgelegten Kindheitstage so bewahrt hat und wachzurufen weiß wie dieser aus Bordeaux stammende Mann, der morgen (17. August) 80 Jahre alt wird und immer noch als besessen arbeitsam gilt. Er selbst findet es verstörend, dass und wie er dermaßen der Kindheit verhaftet geblieben ist. Nebenbei bemerkt, war damals das Radio so kultiviert, dass man sich dort bestes Französisch aneignen konnte.
Es gibt jedenfalls genügend Anlass, mit spürbar liebevollem Aufwand einen Bildband wie „Kindheiten“ herauszubringen, der sich als thematisch gewichtete, veritable Werkschau erweist und dabei ohne seine wohl berühmteste Figur, den „Kleinen Nick“ (Petit Nicolas) auskommt, die Sempé einst gemeinsam mit René Goscinny schuf.
Angesichts seiner frühen Jahre, die das Buch in einem langen Sempé-Gespräch mit Marc Lecarpentier in Erinnerung ruft, ist die milde Heiterkeit des Oeuvres überaus erstaunlich. Sempé sagt es mit den Worten eines Schriftstellers, an dessen Namen er sich nicht erinnert: „Der Mensch ist ein Wesen von untröstlicher Heiterkeit.“ (Hausaufgabe: Wer findet den Urheber heraus?)
In diesem Band kann man beispielsweise verfolgen, wie die durchaus wohlgesetzen Worte zu den Zeichnungen nach und nach schwinden, wie also das rein Bildnerische überwiegt. Immer eigener, feingliedriger und feinsinniger wird die Linienführung, sie übermittelt in seismographischer Weise seelische Zustände. Da bedarf der Worte nicht mehr. Es scheinen ganze Existenzen und Charaktere in knappen, meisterlichen Skizzen auf. Oder auch dies: Dauer, Trägheit und Hitze eines Hochsommertags werden atmosphärisch greifbar. Manche Blätter wiederum erfassen haarfein, was Provinz ausmacht. Man schaue nur, wie die Dorfjugend einer Radfahrerin nachstarrt. Auch für Freud und Leid, Groteske und Grazie des Fußballs abseits der großen Stadien hat Sempé ein untrügliches Gespür. In all diesen Zeichnungen schwingt so vieles mit…
Auch wenn Sempé erwachsene Menschen zeichnet, sind sie oft unverkennbar von Kindheit geprägt. Mal sieht man sie in selten schönen Momenten des Leichtsinns, wenn sie sich unbeobachtet glauben und auf einmal wieder sind wie von klein auf. Andererseits sieht man aschfahl ergraute und erstarrte Herrschaften, in denen jegliche Kindheitsahnung erloschen ist. Zuweilen rücken die Lebensalter in komischen Kontrast: Der Schnitt durch ein Haus offenbart, wie die „Großen“ bei Regen ihre Zeit in Zimmern totschlagen, während oben auf der Dachterrasse eine Kinderschar tobend jeden Augenblick der Nässe mit Haut und Haaren genießt.
Schließlich gibt es in dieser vielfältigen Bildwelt auch jene stocksteif ungelenken, früh verzogenen Bürgersöhnchen oder jene Kinder, denen das Kindsein früh ausgetrieben werden soll, etwa mit strengem Klavier- oder Ballettunterricht. Doch siehe da, sie wehren sich mit Phantasie oder auch ganz handgreiflich: Selbst wenn sie mit Heiligenschein aus Pappe zur Weihnachtsaufführung eilen, knuffen und hauen sie sich unterwegs noch mit heißem Herzen. So kann Kalberei ein Hoffnungszeichen sein.
Sempé: „Kindheiten“. Bildband, Hardcover Leinen, 272 Seiten. Mit einem Gespräch zwischen Sempé und Marc Lecarpentier (übersetzt von Patrick Süskind). 39,90 Euro.