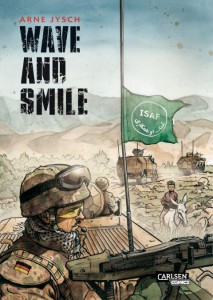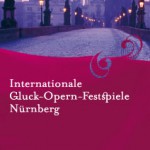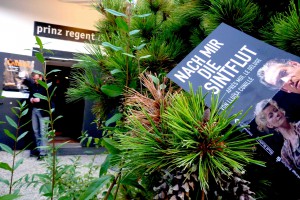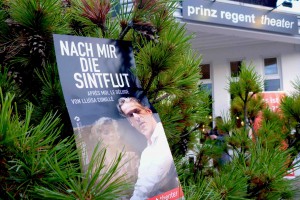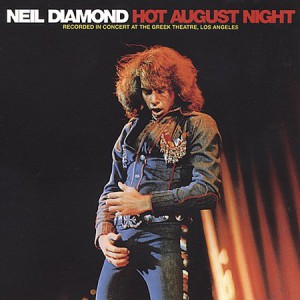Jonathan Darlington hat sich als Chefdirigent der Duisburger Philharmoniker einen Ruf erspielt, der weit über die Grenzen des Ruhrgebiets hinausdrang.
Seine beharrliche Aufbauarbeit, sein Streben nach Verfeinerung ist mehr als der Perfektionsdrang eines technisch ehrgeizigen Dirigenten, mehr als der nach klingendem Erfolg strebende Eros eines Orchestererziehers. Darlington offenbarte in allem, was ich von ihm hörte und erlebte, geradezu einen Drang, in die Tiefenschichten der Musik vorzudringen. Die schöne Stelle, der gelingende Bogen, die harmonische Raffinesse, der Glanz der Farben von Soli und Gruppen, die sensible Balance, die rhythmische Akkuratesse, der virtuose Knalleffekt, das Singen, erfüllt von Sentiment – all das genügt ihm offenbar nicht.
Darlington ist ein Musik-Denker, aber keiner, der vor lauter intellektuellem Skrupel das Zupacken versäumt. So etwas mag man von vielen Dirigenten sagen, wenn man sie loben will: Bei Darlington ist es kein Kompliment, sondern eine Feststellung, erprobt in vielen, nicht immer festtäglichen Konzerten; geläutert – wie einst das Eisenerz in Duisburg – nicht in edlen Festspiel-Auftritten, sondern im Alltag eines oft harten und, ja, auch alles andere als glamourösen Musikbetriebs, angesiedelt zwischen der Aura der Metropolen und der Mühe der Provinz.
Jetzt, da er Duisburg hinter sich gelassen hat, zu neuen Herausforderungen aufbricht, muss man reisen, will man ihn erleben: Manchmal ziemlich weit, bis ins kanadische Vancouver, wo Darlington Musikdirektor der Oper ist. Manchmal aber auch nur zwei ICE-Stunden von Duisburg entfernt, etwa nach Frankfurt, wo er die Eröffnungspremiere der neuen Spielzeit, Samuel Barbers „Vanessa“, leitet.

Bernd Loebe, Intendant der Oper Frankfurt. Foto: Maik Scharfscheer
Barbers 1958 uraufgeführte und selten nachgespielte Oper ist nicht unbedingt das Stück, mit dem ein Opernhaus seine Saison glanzvoll eröffnen würde. Aber der kluge Bernd Loebe schaut nicht auf den Society-Mehrwert eines Spielzeitauftakts. Der Frankfurter Intendant gestaltet das wohl vielseitigste Programm eines deutschen Opernhauses 2012/13 und hat den Mumm, als nächste Premiere nach „Vanessa“ Engelbert Humperdincks „Königskinder“ anzusetzen. Dazwischen „Adriana Lecouvreur“ von Francesco Cilea, „Chowanschtschina“ von Modest Mussorgsky und „L’Etoile“ von Emmanuel Chabrier: Ein populistischer Spielplan sieht anders aus. Aber Loebe hat Erfolg, auch an der Kasse, und deklassiert damit viele Häuser, die mit ihrem Carmen-Rigoletto-Zauberflöte-Einerlei glauben, ein schwindendes Publikum ins Haus locken zu können. Sicher muss man zugestehen, dass Frankfurt ganz anders arbeiten kann als etwa das Aalto-Theater in Essen, dessen Premierenzahl auf jämmerliche Vier geschmolzen ist. Aber Frankfurt zeigt allen Kulturpolitikern, wenn sie es denn wissen wollten, wie eine Oper aufgestellt sein muss, um Erfolge nach Hause zu bringen.
Samuel Barbers „Vanessa“: In der Zeit des stürmischen Aufbruchs der Musik – zu nennen ist nur der bei der Triennale gefeierte John Cage – war die Oper ein Anachronismus. Nicht Schönberg, sondern Puccini: So etwas ging an der Met gut, wo Eleanor Steber und Nicolai Gedda den Melomanen ein süffiges neues Werk zu servieren bereit waren. Das ging nicht gut in Salzburg, obwohl sich, wie in New York, kein Geringerer als der Dirigent Dimitri Mitropoulos in die Bresche warf. Hohn und Verachtung war der Lohn; Barbers Stück war in Kreisen der Avantgarde ein „no go“. Niemand konnte sich leisten, so etwas nachzuspielen, selbst wenn das Herz, ängstlich verborgen vor dem strengen Gericht der zwölftönigen Reihe, eine heimliche Träne vergoss. Entsprechend dürftig war die Rezeption von „Vanessa“ in der Alten Welt.
Das hat sich gründlich verändert, und Jonathan Darlington zeigt in Frankfurt, warum. Barbers Musik ist kein dahingezaubertes Soufflé, um ältliche Sponsorinnen in Manhattan zu entzücken. Der Mann hat täglich Bach studiert – und das ist ebenso zu hören wie die Vertrautheit mit den modernen Strömungen des Komponierens. Nur: Barber will kein Epigone all jener sein, die auf den gerade aktuellen Zug aufspringen. Er macht sein Ding, ohne Skrupel, ohne nach dem Beifall der Richtung zu schielen, die zu seiner Zeit en vogue war. Heute, da die alten Fronten bedeutungslos geworden sind und die Avantgarde der Fünfziger – teils auch zu Unrecht – vergessen ist, hört man, wie sensibel der studierte Sänger Barber für seine Protagonisten schreibt, hört man auch, wie komplex er mit Motiven umgeht, wie er Bausteine verwendet, die von Puccini bis Janáček, von Strauss bis Strawinsky stammen könnten. Doch er verarbeitet sie zu einer ganz eigen geprägten musikalischen Sprache.
Darlington dirigiert das versierte Frankfurter Opernorchester möglichst transparent, arbeitet genau jenes Baustein-Prinzip heraus, belastet nichts durch dunkel-üppigen Klang, zieht aber auch die emphatische melodische Linie aus, wo es verlangt ist, ohne Berührungsängste, ohne Scheu vor dem Eklektischen. So fügt sich das Spiel mit dem Detail zu einem großen Ganzen, und wenn die schroffen Tutti, die tubaschweren Bläserattacken manchmal zu laut geraten, nimmt das dem Gesamteindruck nichts weg. Darlingtons Debüt an der Frankfurter Oper war eine sinnliche und eine intellektuelle Freude.
Auf eine sinnliche Ästhetik setzt auch die aus Malmö übernommene Inszenierung der früheren Frankfurter Regieassistentin Katharina Thoma. Die Regisseurin arbeitet seit 2011 regelmäßig an der Dortmunder Oper und hat dort Cavallis „Eliogabalo“ und Puccinis „La Bohème“ inszeniert. Am 30. September wird sie mit Mussorgskys „Boris Godunow“ die Spielzeit eröffnen und im Februar 2013 Verdis „Troubadour“ szenisch verantworten. Julia Müer hat ihr ein durch eine zentrale Achse geteiltes Bühnenbild gebaut: auf der einen Seite eine großbürgerliche Villa, auf der anderen ein abweisendes Feld von Eisschollen, die sich unbehaglich in den Wohnraum schieben. Olaf Winters manchmal gespenstisch fahles, dann wieder eisig grelles Licht schafft die Atmosphäre für das zwischen Tschechow’schem psychologischem Realismus und dem bleiern-geheimnisvollen Symbolismus einer „Gothic Novel“ changierenden Libretto von Barbers Lebensgefährten und Komponisten-Kollegen Gian Carlo Menotti.

Das Bühnenbild für "Vanessa" von Julia Müer vereinigt Realismus und Symbolismus.
Thoma lässt aus einem Zustand der Starre ein Kammerspiel herauswachsen, das sich mit vielen klug beobachteten Details eher an der psychologischen Milieustudie als am symbolistisch geladenen Drama orientiert – wie es etwa Regisseur Matthias Oldag 2005/06 am Theater Gera-Altenburg in einer gespenstisch mehrdeutigen Studie realisierte. Thoma entdeckt in „Vanessa“ ein Stück über die Verweigerung von Kommunikation. Das ist die Oper zweifellos, aber sie thematisiert auch die Angst vor der Zeit und der Authentizität.
Thoma verwendet symbolische Zeichen, ohne dem Symbolismus nahezutreten. Die Spiegel sind eines, die das Libretto vorgibt: Im Hause sind sie alle verhüllt, um den Fortgang der Zeit zu verbergen. Doch wenn Vanessa schon in den ersten Minuten der Oper eine Tür aufreißt, schließt ein riesiger Spiegel die Öffnung: Die Verweigerung der Wahrheit macht die Menschen zu Gefangenen. Ein anderes findet Thoma in dem Namen „Vanessa“, der auch in der zoologischen Bezeichnung eines Schmetterlings vorkommt: Anatol, der Mann, der in das hermetische Haus eindringt, berührt ein in einem Sammelkasten aufgespießtes Insekt, das befreit davonflattert.
Bei aller Sorgfalt im Detail tut sich die Regisseurin manchmal schwer, die Personen scharf zu entwickeln: Die damenhaft auftretende und vor allem in der Mittellage überzeugend singende Charlotta Larsson gibt eine Vanessa, deren Ungeduld eher diejenige einer verwöhnten Upper-Class-Gattin ist. Wer nach zwanzig Jahren aus der Starre des Wartens gelöst wird, wirft nicht zickig Klaviernoten auf den Boden.
Der Anatol des vor allem in der Höhe gefährdet singenden Kurt Streit, der das lang erstarrte Eis in Bewegung bringt, macht nicht begreifbar, welche Dynamik von seiner Ankunft ausgeht: Vanessa erwartet ihren vor zwanzig Jahren verschwundenen Geliebten, doch statt seiner erscheint ein Unbekannter, der sich als Sohn jenes Anatol ausgibt. Streit wirkt wie ein biederer englischer Verwalter, der zufällig zu Besuch kommt. Auch Helena Döse, die „alte Baronin“, erschöpft sich als skurrile Schweigerin; der unheimliche, bedrohliche Zug dieser Figur geht ihr ab. Aus dem Doktor macht Dietrich Volle eine Charakterstudie mit komischen Zügen, die tragischen holt er nicht ein. Björn Bürger legt den Haushofmeister als Widerschein der Starre des Hauses an, den in der Ballszene des zweiten Akts schon ein Damenpelz in erotische Zuckungen versetzt.

Kurt Streit (Anatol) und Jenny Carlstedt (Erika) in Samuel Barbers "Vanessa". Fotos: Barbara Aumüller
Der heimliche Star der Aufführung ist Jenny Carlstedt aus dem Frankfurter Ensemble: Ihre intensive Darstellung macht aus der Figur der Erika eine Fallstudie über die Tragik der unmöglichen Liebe, über Realitätsaneignung und –verweigerung. Als „Schatten Vanessas“ stellt sich das junge Mädchen – die Nichte der Hausherrin – vor. Ihr kurzes Abenteuer mit Anatol, ihre idealistische Auffassung von Liebe, ihr Weigerung, das Kind aus diesem Augenblick der Hingabe und Leidenschaft zu gebären; am Ende ihre Erstarrung im Warten auf etwas, das nie eintreten wird, weil es keinen Begriff dafür gibt – für alle Facetten der Figur findet Carlstedt in Gestik und Körperhaltung, mehr noch aber in Farbe und Führung der Stimme faszinierenden Ausdruck. In dem Lied „Must the winter come so soon“ ist es die wehmütige Lyrik; in ihrem Zusammenbruch sind es groß angelegte, aber auch tonlos fahle Phrasen. Am Ende bleibt die kalkige Härte einer Frau, die sich wie niemand sonst der Wahrheit gestellt hat und vor ihr versteinert. Der Mann im Eis wird ihr, das ist in den letzten verwehenden Klängen von Barbers Musik klar, niemals nahe kommen.
Jonathan Darlington dirigiert „Vanessa“ noch am 6., 9., 14., 20., 22 und 28. September. Am 28. Oktober gastiert er als Liedbegleiter in einem Kammerkonzert an seinem alten Wirkungsort Duisburg. Im Januar und Februar 2013 ist er mit Händels „Orlando“ und Mozarts „La Clemenza di Tito“ an der Semperoper Dresden zu Gast. Die langjährige Zusammenarbeit mit der Deutschen Oper am Rhein setzt Darlington im Juni 2013 fort: Er verantwortet musikalisch die Neuinszenerung von Alexander Zemlinksys Opern-Duo „Der Zwerg“ und „Eine florentinische Tragödie“. Premiere ist am 15. Juni.