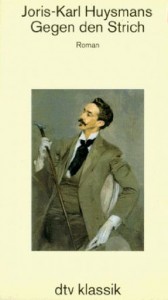Unter dem Brennglas: „Don Carlos“ am Musiktheater Gelsenkirchen

Frankreichs weiße Lilie: Elisabeth (Petra Schmidt) wird bald nach ihrer Ankunft im Escorial in ein steifes schwarzes Kleid gezwängt (Foto: Pedro Malinowski/ MiR)
Gott, welch Dunkel hier. Alle tragen schwarze Kleidung, als seien sie fortwährend in Trauer. Der Escorial, von Philipp II. als Schloss- und Klosteranlage erbaut, gleicht einer fensterlosen Gruft, einem Gefängnis mit nackten Wänden.
In dieser düsteren Szene zeigt Regisseur Stephan Märki wie unter einem Brennglas, was die Figuren in Giuseppe Verdis Oper „Don Carlos“ umtreibt. Seine Neufassung am Gelsenkirchener Musiktheater erreicht dabei schneidende Intensität.
In schlichter, aber höchst wirkungsvoller Schwarz-Weiß-Ästhetik zeigt Märki einen elementaren Kampf: Unschuld, Liebe und Hoffnung gegen Gewalt, Furcht und Depression. Die stufenweise ansteigende Spielfläche ist niederschmetternd kahl (Bühne: Sascha Gross). Hier umkreisen sich die Akteure, belauern sich misstrauisch. Schattenrisse flackern auf, Spannungen werden beinahe mit Händen greifbar. Unter dem alles erstickenden Schwarz brodeln die Emotionen. Märki kanalisiert die unterdrückte Energie, bis die Figuren förmlich zu vibrieren beginnen. Hinter den individuellen Dramen leuchten die großen Menschheitsfragen auf. Welchen Preis hat die Macht? Was kostet die Freiheit?
Abseits der spannungsvollen Personenführung findet die Regie immer wieder zu klaren, kraftvollen Bildern. Ein kleines Mädchen, das zu Beginn im weißen Kleid über die Bühne hopst, kehrt im Autodafé als „Stimme vom Himmel“ wieder. Elisabeth sinniert vor einem Altar mit Totenschädel über Wahn und Eitelkeit der Welt. Die verblühten Rosen, die sie ergreift, treiben den Stachel ihrer Wehmut noch tiefer. Unterdessen quält sich der einsame Monarch durch eine schlaflose Nacht, die durch schemenhaft erkennbare Leichen im Bühnenhintergrund vollends gespenstisch wird. Überzogen dargestellt wirkt indes der Machtanspruch des Großinquisitors, den Märki im zweiten Teil als Christusfigur samt Dornenkrone und Wundmalen auftreten lässt.
Musikalisch hebt die Produktion unter Dirigent Rasmus Baumann zu Höhenflügen ab. Die Neue Philharmonie Westphalen begeistert durch eine Motivarbeit, die in psychologische Tiefen führt. Dämonisch finsteren Ausbrüchen steht eine teils glühende, dann wieder beglückend fein gesponnene Italianità gegenüber. Präzise Blechbläser und Streicher, die eine vielschichtige Piano-Kultur entwickelt haben, lassen immer wieder aufhorchen. Dies kommt wiederum dem durchweg gut besetzten Sängerensemble entgegen. Daniel Magdal entwickelt als Don Carlos trotz einiger greller Farben und Schluchzer beachtliche Strahlkraft. Renatus Mészár gibt Philipp II. stählerne, aber auch warme Klänge, die er im depressiven Sprechgesang der Arie „Sie hat mich nie geliebt“ zu erschütterndem Melos steigert. Carola Guber trumpft als Eboli glamourös, zunächst aber etwas kalt auf, bevor sie sich der Königin in glühender Reue zu Füßen wirft. Petra Schmidt gelingt als Elisabeth die Gratwanderung zwischen Stolz, Wehmut und Verletzlichkeit. Und Michael Tews ist ein Großinquisitor, dessen Bass einen das Fürchten lehrt. Wahre Triumphe feiert der von Berlin als Gast zurück gekehrte Günter Papendell, der sein Rollendebüt als Marquis Posa mit kraftvoll und mit warm timbriertem Bariton meistert.
Zu erleben ist mithin ein Drama, das alles bis auf die Grundmauern unserer Existenz nieder brennt. Wir erfahren von zerschellten Hoffnungen, von Unterdrückung und Heldenmut, von der unstillbaren Sehnsucht nach Freiheit, ja nach einer besseren Welt. Und es ist, als lächle Verdis Genie uns mitleidsvoll zu.
(Der Text ist zuerst im Westfälischen Anzeiger erschienen. Termine und Informationen: www.musiktheater-im-revier.de)