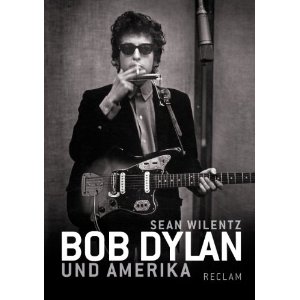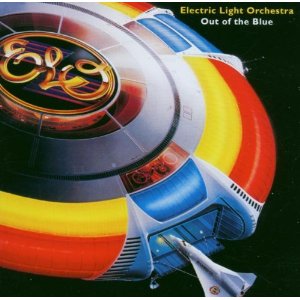„Er stiehlt, was er liebt und liebt, was er stiehlt“: Bob Dylan und Amerika
Ich ahnte es ja schon lange. Je länger er mich und Millionen verborgene und offen bekennende Fans begleitete, wurde mir deutlicher: Es ist gar nicht so verquer, wenn sein Name dann und wann unter denen auftaucht, die für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen werden. Robert Allen Zimmerman, besser bekannt als Bob Dylan, ist aber – wie wir wissen – bislang nie in diesen Olymp aufgestiegen.
Dennoch, er ist ein Poet von amerikanischem Rang, er ist auf seine Art ein Musiker von amerikanisch-epochaler Bedeutung und er ist eine Figur, die im künstlerischen Szene-Personal der vergangenen Jahrzehnte nahezu an jeder Stelle von Rang in Amerika auftaucht. In seinem Buch „Bob Dylan und Amerika“ erzählt Sean Wilentz manches, was man noch nicht über Bob und Amerika wusste, aber schon länger hätte wissen sollen. „Bob Dylan und Amerika“ ist eine Art Zeitengemälde, in dem Bob Dylan wie ein „Hobo“ (wanderarbeitender Landstreuner) seine Spuren durch ein Land zieht, das ihn und wegbegleitende Gefährten ebenso liebt wie abweist. Eines seiner Idole ist nicht zufällig Woody Guthrie, der den „Hobo“ freiwillig nachlebte.
Sean Wilentz saß laut Klappentext als 13-jähriger Knabe 1964 in der New Yorker Philharmonic Hall und hörte dem zehn Jahre älteren Bob Dylan zu, der mit Joan Baez die Fans in der Halle fesselte. Der Autor und aktuelle Geschichtsprofessor an der Princeton Universität blieb fortan Gefangener, verfolgte und erforschte den Weg seines ewig nölenden Helden, avancierte zu dessen „Haus-Historiker“ und schrieb nun ein Buch darüber, was Bob Dylan während seines bisherigen Lebensweges getan hat und von wem er wozu angestoßen worden war.
Und da sind wir wieder bei „Amerika“, genauer bei den USA. Das Land, seine Geschichte und seine positiv wie negativ prägenden Persönlichkeiten ließen Dylan sein Künstlerleben so kreativ leben, wie er es tat. Aaron Copeland wirkte auf seine Musik ein, ebenso natürlich die Legende Woody Guthrie. Allen Ginsberg belebte seine Sprache, ebenso wie Jack Kerouac, an dessen Grab er sich mit Ginsberg fotografieren ließ. Bob Dylan hatte echte Freude daran, dass er „noch einen Zipfel der Beat-Generation mitbekommen hatte“. Walt Whitman, der Dichter des Bürgerkrieges, inspirierte ihn ebenfalls.
Anarchische Clowns wie Charlie Chaplin zählten zu seinen Lieblingen. Es wirkt fast deplatziert, dass Marcel Carnés Film „Kinder des Olymp“ Einfluss auf ihn nahm, Dylan sich auf diese ureuropäische Poesie einließ und die „commedia dell’arte“ ihn berührte. Dylan ließ sich von Marc Knopfler produzieren und spielte legendäre Konzerte mit den „Travelling Wilburys“. Er wurde auch gläubig, trat vor Papst Johannes Paul II. auf und intonierte „Knockin‘ on Heaven’s Door“. Doch für Knut Wenzel, Professor für Fundamentaltheologie und Dogmatik an der Goethe-Universität Frankfurt, steht es fest, dass „die Phase der Christlichkeit bei Dylan eine von vielen Maskierungen“ gewesen sei. Neben denen des Stars, des Familienmenschen, Streuners, Revoluzzers, Polit-Aktivisten, Predigers und Pilgers.
Vermutlich ließe sich diese Liste noch lange fortsetzen. Sean Wilentz wird in seinem Buch nicht müde, die zahllosen Einflüsse und Zulieferer für Bob Dylans anscheinend unerschöpfliche Kreativität auf seiner „Never Ending Tour“ zu benennen. Er prägte vieles, das die Nachkriegszeit Amerikas erinnernswert macht, er wies Wege und Grenzen, er spielte sich und allerlei „Ichs“, nach denen er auf der Suche war. Er versucht nach wie vor, für sich die „Western Frontier“ zu finden.
Rebellion ist, das glaubt Wilentz fest, eine zentrale Vokabel für Bob Dylan. Solange wir ihn kennen, wird er mit deren Inhalt in Verbindung gebracht. Als Stimme einer protestierenden Bewegung, als Poet des nachdenklichen und widerständigen Amerikas, als Rock’n’Roller, lauter Rufer und bergpredigender Weiser, der er einmal werden möchte. Stets auf der Suche nach Einflüssen, die er mitnehmen, umdeuten und in sein dylaneskes Werk verarbeiten könnte. „Er stiehlt, was er liebt und er liebt, was er stiehlt.“ Das schreibt sein Haus-Historiker über ihn. Dylan, der Bertolt Brecht Amerikas?
Das und noch mancherlei mehr macht Sean Wilentz Buch deutlich, und zwar so nachhaltig, dass ich es alsbald noch einmal lesen muss.
Sean Wilentz: „Bob Dylan und Amerika“. Aus dem amerikanischen Englisch von Bernhard Schmidt. Reclam Verlag, Ditzingen. 477 Seiten, 29,95 Euro.