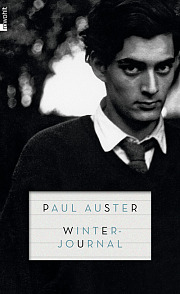Theater Oberhausen: Im Bett mit Brecht
Ist Theater wie Sex: Die Schauspieler stimulieren die Zuschauer? Oder ist Theater ein Hospiz, in dem man der Kultur beim Sterben zuschauen kann? Das Theater Oberhausen lädt sein Publikum ein zum Nachdenken über Theater. „Brecht“ ist ein Mixed-Media-Abend auf der Meta-Ebene – eine Mischung aus Puppenspiel und Schauspiel, Improvisation und Quatsch.
Im Zentrum steht Brecht, eine wundervoll gestaltete Puppe der renommierten Puppenspielerin Suse Wächter, die an diesem Abend auch Regie führt. Ihr Brecht misst etwa einen Meter und hat einen sensationell gönnerhaft-selbstgefälligen Gesichtsausdruck: Wenn er mit halb geschlossenen Lidern pastoral um sich blickt, an seiner kalten Zigarre saugt und mit Augsburger Zungenschlag krächzt: „Nach uns wird kommen – nichts Nennenswertes“ – dann tut das eigentlich seine Schöpferin Suse Wächter neben ihm. Doch das hat der Zuschauer schnell vergessen.
Brecht liegt in einem riesigen Bett mit allerlei technischem Schnickschnack (Bühne: Constanze Kümmel), inmitten hübscher Schauspielerinnen. Sie kommen aus dem Hier und Jetzt, surfen nebenbei im Internet, telefonieren via Skype – und wollen mit Brecht proben, weshalb sie ihm in einer Prüfung demonstrieren, dass sie sein Konzept des epischen Theaters samt Verfremdungseffekt verstanden haben. Mit Wisch-Bewegungen zaubern sie übereifrig immer neue Infografiken auf die Leinwand und präsentieren ihre Lektionen: Der Einfühlungsakt muss unterbunden werden! Jede Geste muss als theatralisch erkennbar sein!
So richtig warm werden die Akteure mit dieser Spiel-Art jedoch nicht, das wird schnell klar: Brechts Theaterkonzept ist Schulstoff, ist Geschichte und weit weg von dem Theater-Verständnis der Schauspieler (Susanne Burkhard, Angela Falkenhan, Puppenspielerin Tine Hagemann und Publikumsliebling Torsten Bauer in Frauenrolle).
Der Fortgang der Proben wird auch dadurch erschwert, dass ein Text fehlt: Brecht muss zugeben, dass er leider „die Rechte nicht hat“ – eine Anspielung auf das Gebaren der Erben des Dichters, die nur werkgetreue Inszenierungen zulassen.
Im Laufe des Abends emanzipiert sich das Ensemble vom Übervater, und Brecht katapultiert sich mit einem Videospiel selbst auf den Mond, während die Schauspieler unter Einsatz von Theaternebel und Drehbühne ins von Brecht so verhasste Reich der Illusionen entschwinden.
Die Frage, die über dem Abend schwebt – was hat Brechts Theater uns heute noch zu sagen? – bleibt offen, was nicht weiter schlimm ist. Ärgerlich ist, dass eine Antwort gar nicht ernsthaft gesucht wird. Es bleibt bei der Versuchsanordnung, den alten Brecht auf die moderne Welt treffen zu lassen. Und was da passiert, ist allzu banal: Brecht findet den via Skype zugeschalteten Helge Schneider als Bruder im Geiste „phantastisch“; wundert sich über Spock und versagt beim virtuellen Autorennen auf ganzer Linie.
Was würde Brecht dazu sagen, dass das heutige Publikum Theater nicht mehr braucht, um aus der Realität zu flüchten, weil man dies mit jedem Fernseher und Computer kann? Ist Brechts Technik der Verfremdung heute endgültig sinnlos – oder wird sie im Gegenteil wieder wichtig? Man hätte vom alten Brecht gerne mehr gehört, streckenweise wurde er von seinem Ensemble in den Hintergrund gespielt bzw. in einer an René Pollesch erinnernden Szene zusammengeschrien: Schauspieler Bauer rechnet darin mit den Bedingungen für Schauspieler am Theater ab.
„Brecht“ hat viele unterhaltsame, mitunter alberne Momente; etwa, wenn Klassiker verulkt werden: „Edel sei der Mensch, Milchreis schmeckt gut“. Insgesamt wirkt die Produktion noch ein wenig unfertig, gut einstudierte Szenen wechseln ab mit arg improvisiert wirkenden. Auch für ein Theaterlaboratorium fehlt es an Stringenz.