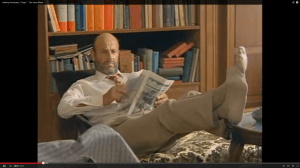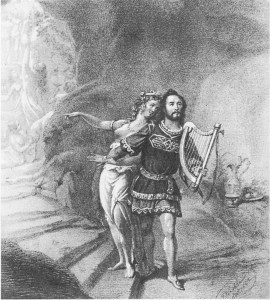Die Frankfurter Oper hat es wieder einmal geschafft: Mit einer Inszenierung von Christoph Willibald Glucks „Ezio“ entriss sie ein Werk aus dem Dämmerschlaf, das noch vor Glucks bedeutsamen Reformopern entstanden ist. Gleichzeitig gelang dem Haus von Bernd Loebe damit das Präludium zum Gluck-Jahr: 2014 jährt sich die Geburt dieser wichtigen Gestalt der Musikgeschichte zum 300. Mal.

Edle Roben: Christian Lacroix schuf die Kostüme für Glucks „Ezio“ In Frankfurt. Sene mit Max Emanuel Cencic, Paula Murrihy und Beau Gibson. Foto: Barbara Aumüller
Die Ausgangslage ist wie bei solchen Jubiläen üblich: Einige kleine Häuser in der deutschen Theaterlandschaft kündigen Premieren von Gluck-Opern an, die Flaggschiffe steuern unbeirrt daran vorbei. Ob sich an diesem Bild noch etwas ändern wird, wenn im Frühjahr die Pläne für die Spielzeit 2014/15 publiziert werden, steht noch dahin. Obwohl ein Komponist wie Gluck dringender eine zeitgenössische theatrale Befragung bräuchte als etwa Wagner.
Das ist kein Plädoyer für ein Opernmuseum: Sicher klaffen die musikhistorische Stellung und die aktuelle Bedeutsamkeit von Komponisten oder Werken bisweilen weit auseinander. Doch gerade die letzten Inszenierungen des „Ezio“, einer noch stark an den Konventionen der „opera seria“ orientierten Oper, lassen spüren, wie brisant ein Libretto des lange als Barock-Langweilers geschmähten Metastasio wirken kann, und von welch unterschiedlichen Positionen aus sich eine Regie der Gefühls- und Affektwelt des 18. Jahrhunderts nähern kann.
Vincent Boussard macht es in Frankfurt ganz anders als Andreas Baesler 2012 in Nürnberg. Dort verlegte eine freche, bestürzend aktuelle Regie den „Ezio“ in die Tiefgarage des Staatstheaters, verwandelte die Rezitative in Sprechtext, ließ die Sänger von Schauspielern doubeln, bot eine knallharte, temporeiche Action-Tragödie. Jetzt, in Frankfurt, wehrt sich die Regie im Schulterschluss mit dem genau analysierenden Dirigenten Christian Curnyn gegen Eingriffe in Glucks Musik, mutet dem Zuhörer von heute die ausführlichen Rezitative von damals zu.
Was Baesler in Nürnberg als brutales Kammerspiel herunterfetzte, wird in Frankfurt zu hochästhetischer theatralischer Aktion. Doch man sollte sich hüten, Stilisierung mit einem Verlust an Relevanz und packender Wirkung gleichzusetzen. Manchmal sind sparsame Gesten, Verzicht auf angeheizte Erregungszustände und Abstand von starken Effekten ergreifender als der zappelige Aktionismus, der noch die letzte musikalische Sekunde szenisch gewichten will.
Boussard spitzt das Drama um den neurotischen Machtinhaber Kaiser Valentinian, seinen von Ehrgeiz und Loyalität geschüttelten Feldherrn Ezio, der alptraumhaft rachsüchtigen Vaterfigur Massimo und den beiden Frauen Fulvia und Onoria ganz allmählich zu. Das führt im ersten Teil des gut dreistündigen Abends zu einigen Durchhängern, wenn die gepflegte und aufmerksame Gestaltung der Rezitative szenisch erlahmt oder von abgelebter Melodramengestik flankiert wird. Doch je mehr sich das Netz zuzieht, je verzweifelter sich die Figuren im Labyrinth ihrer Gefühle, Intrigen und Psychosen verrennen, desto eindringlicher spielen die Darsteller, desto schärfer zeichnet die Regie die Konturen des psychischen Verfalls, der seelischen Zerrüttung.

Paula Murrihy als Fulvia und Beau Gibson als Massimo in Glucks „Ezio“. Foto: Barbara Aumüller
Vor allen anderen gelingt Paula Murrihy ein gesanglich intensives, darstellerisch bewegendes Porträt einer Frau, deren seelische Qual jedes Maß sprengt: Fulvia liebt Ezio, wird vom Kaiser begehrt, von dessen Schwester Onoria mit Missgunst verfolgt und von ihrem eigenen Vater Massimo als Instrument seiner Rache an Valentiniano missbraucht. Die Sängerin klagt mit innig geführtem Mezzosopran über ihren zerstörten existenziellen Halt, kann erhabene Verzweiflung wie edle Menschlichkeit expressiv stimmlich darstellen.
Murrihy ist nicht die einzige, die vokal überzeugen kann: Mit Max Emanuel Cenčić steht als Valentiniano einer jener seltenen Counter, denen man die artifizielle Tonbildung dank einer soliden Technik problemlos abnimmt. Cenčić zeichnet den Kaiser – der historische Valentinian III. herrschte 30 Jahre lang im Weströmischen Reich – als eine Figur von shakespearehaften Dimensionen: machtbesessen und dennoch ohnmächtig den Intrigen ausgeliefert; selbstherrlich und brutal und dennoch fast infantil schwach; renaissancehaft selbstbewusst und dennoch seinen nagenden Zweifeln bis zum Verfolgungswahn ausgeliefert.
Cenčić drückt diese schillernde Figur stimmlich ausgezeichnet, in seiner Bühnenaktion oft mit auffahrenden, aber wenig profilierten Gesten aus. Den Ezio verkörpert Sonia Prina mit einem satten „Contralto“, der manchmal ebenmäßiger geführt sein könnte – eine energische, völlig von sich eingenommene Figur mit einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein. Cenčić und Prina sind auch Protagonisten einer „Ezio“-Aufnahme unter Alan Curtis, die 2011 bei Virgin Classics erschienen ist.
Auch die Rollen in der zweiten Reihe kann Frankfurt ansprechend besetzen: Sofia Fomina hat für Neid wie Mitgefühl brillante Töne; Beau Gibson gibt dem Massimo die paranoid-gefährlichen Züge eines Triebtäters, aber auch die schleichende Gefährlichkeit des Intriganten; Simon Bode versucht erfolgreich, den Varo aus seiner Nebenrollen-Ecke herauszumanövrieren und gibt ihm das Profil eines willig dienenden Staatsglieds, das aber im richtigen Moment die menschliche Regung der Freundschaft über die geschuldete Räson siegen lässt und damit das „glückliche Ende“ ermöglicht.

Licht- und Schattenspiele als Mittel szenischen Ausdrucks: Sonia Prina als Ezio in Glucks gleichnamiger Oper in Frankfurt. Foto: Barbara Aumüller
Mit den fulminanten Roben des Modeschöpfers Christian Lacroix landete die Frankfurter Oper einen Coup, der ihr die Aufmerksamkeit des Boulevards sicherte. Barocke Flamboyanz, gediegenes bürgerliches Tuch, malerische Fantasie – so lassen sich die Elemente beschreibe, die Lacroix nutzt, um die Bühne Kaspar Glarners zu beleben. Die ist wieder einmal einer der weißen Kästen, an denen man sich in Frankfurt satt sehen kann. Mit beziehungsreichen Licht-Schatten-Spielen von Joachim Klein ermöglichen die kahlen Wände gleichnishafte wie gespenstisch-surreale Bilder, zusätzlich verlebendigt durch behutsam die Stilisierung stützende Videos der stets einfühlsam arbeitenden Bibi Abel.
Bis die heillosen Verwicklungen endlich gelöst werden können, haben Glarner und Boussard die Bühne mit einer allmählich wachsenden Schar von Imperatoren-Statuen zugestellt, die an den berühmten Augustus von Prima Porta erinnern. Zwischen ihnen streifen Touristen in Alltagskleidern herum, glotzen und fotografieren – und drängen die Personen des Dramas aus dem Fokus der Aufmerksamkeit. Was Boussard damit auch erzielen wollte – es bleibt unerreicht; der Bruch der Handlung verfängt nicht schlüssig, sagt uns über Metastasios ausgefeiltes Psychospiel im barocken Rahmen hinaus nichts Erhellendes über die Figuren und ihre Konstellationen.
Umso mitteilsamer ist die Musik: Christian Curnyn und die 27 Musiker des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters bringen Glucks Musik leicht und leuchtend zum Klingen. Sie leugnen nicht, dass der „Ezio“ von 1750 – man spielt die frühere Prager Fassung – vergeblich nach den Errungenschaften der späteren Reformopern suchen lässt. Aber das ist kein Nachteil, denn Gluck beherrscht sein Handwerk und setzt es in den vielfältigen formalen Varianten von Rezitativ und Arie virtuos ein.
Doch zeigt sich im „Ezio“ schon, dass Gluck den Bezug zwischen Wort und Musik – im Gegensatz zu Händel in seiner „Ezio“-Vertonung – offenbar für so bedeutsam erachtet, dass er manche musikalische Finesse der dramatischen Schlagkraft opfert. Curnyn freilich bleibt dezent: Von den schlagkräftigen Wirkungen, die Gluck – und, nicht zu vergessen, sein Schüler Antonio Salieri – später einsetzen, ist in diesem „Ezio“ nur manchmal zu hören, wenn Curnyn kräftige Akzente zulässt. Es wird sich zeigen, wie sich die Frankfurter Gluck-Initiative auswirkt; am Main steht jedenfalls ab 8. Dezember mit Georges Enescus „Oedipe“ die nächste selten zu erlebende Oper um einen antiken Stoff auf dem Spielplan.