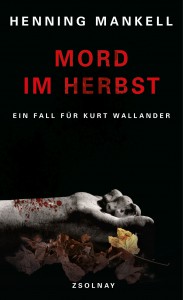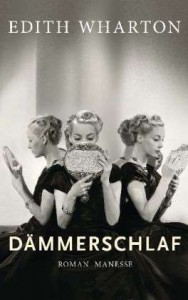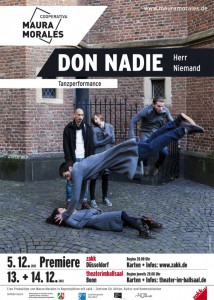„Oh, muss das sein, Miss Sophie?“: Vor 50 Jahren wurde das Silvester-Fernsehritual aufgezeichnet

Same procedure as every year … Foto: NDR, Annemanrie Aldag
Wie wär’s mit folgendem Silvestermenü? Als Vorspeise wählen wir eine Mulligatawny-Suppe. Das ist eine Köstlichkeit aus Hühnerbrühe mit Gemüsen und vor allem Zwiebeln und Curry. Sie wurde in England gerne serviert und stammt noch aus der Kolonialzeit. Dazu reichen wir einen alten trockenen Sherry. Es folgt der Fisch, idealerweise Schellfisch aus der Nordsee, kredenzt mit einem Glas Weißwein, vielleicht einem Rheinriesling. Zum Fleischgang, einem Hühnchen, passt ein feines Glas Champagner. Und den süßen Abschluss bilden gesunde Früchte: Äpfel, Birnen, Mandarinen, Bananen. Ein süßer Portwein rundet dann das Mahl.
Wem dieses Menü bekannt vorkommt, hat in den letzten Jahrzehnten an Silvester gut zugeschaut: Es ist die Speisenfolge des „Dinner for one“, das Butler James zum 90. Geburtstag von Miss Sophie aufträgt. Wir kennen es alle: Die Dame hat vier Gäste geladen, die sich dummerweise aber infolge Ablebens nicht mehr von irdischer Speise nähren. So obliegt es dem Butler, zumindest die Pokale der vier Herren zu leeren, denn Miss Sophie legt Wert aufs Zutrinken und einen Trinkspruch. So nimmt das weinselige Schicksal seinen Lauf – und James kämpft nicht nur mit Tigerschädeln, Silbertabletts und Blumenvasen …
Vor 50 Jahren, 1963, wurde der Sketch mit May Warden und Freddie Frinton in der ARD-Sendung „Guten Abend, Peter Frankenfeld“ ausgestrahlt und im Juli in Hamburg aufgezeichnet. Zwei Jahre zuvor lief er bereits in der Sendung „Lassen Sie sich unterhalten“ mit Evelyn Künneke. Davon gibt es aber keine Aufzeichnung. Seit 1972 gehört „Dinner for one“ zum festen Ritual der Silvester-Unterhaltung. Im Guinness-Buch der Rekorde landeten die achtzehn Minuten in Schwarz-Weiß 1988 als „weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion“.

Unerschöpfliche Quelle der Heiterkeit: James, alias Freddie Frinton, und der Tiger. Foto: NDR, Annemarie Aldag
Obwohl Frinton das Stückchen in den vierziger und fünfziger Jahren in England häufig bei Unterhaltungsshows in Seebädern und Großstädten spielte, ist es heute dort weitgehend unbekannt. Im britischen Fernsehen war er nie zu sehen. In vielen anderen Ländern, von Australien bis Südafrika, von der Schweiz bis Grönland, ist „Dinner for one“ dagegen ein ähnliches Kult-Ereignis wie in Deutschland. May Warden und Freddie Frinton haben sich mit dieser liebenswerten Miniatur ein Denkmal gesetzt – die beiden wären sonst längst vergessen. So heißt es – wie jedes Jahr – an Silvester wieder: „The same procedure as every year, James!“
Mehr als jeder dritte Bundesbürger – 37,5 Prozent – sieht sich an Silvester in der Regel im Fernsehen „Dinner for One“ an. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Apothekenmagazins „Senioren Ratgeber“. Wer sich in die Schar einklinken will: Der Sketch läuft in den Dritten Programmen der ARD zwischen 17.40 und 19.40 Uhr. Der WDR zeigt Miss Sophies Geburtstag um 18.50 Uhr. Für Spätgucker: Im NDR läuft er um 23.35 Uhr. Und nach dem Anstoßen auf 2014 kann man im Bayerischen Fernsehen gleich weitermachen: Auftritt von „James“ ab Mitternacht.
Der NDR widmet der unsterblichen Sendung eine Jubiläumsshow an Silvester: Von 09.10 bis 10.55 Uhr treten drei prominente Teams zu einem heiteren Wettkampf rund um „Dinner for one“ an. Heute, 30. Dezember, zeigt der NDR ab 22 Uhr eine einstündige Spurensuche rund um die – laut NDR – erfolgreichste Fernsehsendung der Welt: „Glückwunsch, Miss Sophie – 50 Jahre ‚Dinner for one‘: Das Erfolgsgeheimnis des Kultsketches“.Die Sendung wird an Silvester um 10.55 Uhr wiederholt.