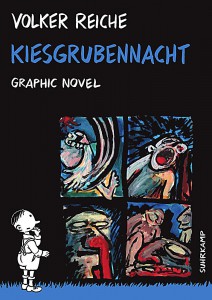Geierabend 2014: Schwarzhumor aus der Grube
Einst war Kabarett relevant. Kabarettisten wie Dieter Hildebrandt kommentierten mit Schärfe die Missstände in Politik und Gesellschaft. Ins Kabarett ging man nicht nur in Erwartung eines bierseligen Schenkelklopf-Abends, sondern durchaus in dem Bewusstsein, dort auf Standpunkte zu treffen, die dazu beitragen können, sich eine (andere) Meinung zu bilden. Solche Kabarettisten gibt es heute immer noch, sicher. Doch sie erreichen längst kein Massenpublikum mehr. Wenn ein Comedian heute Stadien füllt, dann mit flachen Witzen über die Geschlechter und ihren fortwährenden Kampf, eine offenbar bodenlose Fundgrube.
Umso bedeutsamer ist, dass sich der Dortmunder Geierabend mit seinem aktuellen Programm („Späßchen in der Grube“) dazu entschieden hat, noch konsequenter auf Gegenkurs zu gehen. Die Comedy-Show zum Ruhrpott-Karneval, eine Art Stunksitzung des Reviers, geht in diesem Jahr in ihre 23. Session. Sie hat ihre treue Fan-Gemeinde, und viele warten vor allem auf die Kult-Nummern im Programm: „Die Zwei vonne Südtribüne“, besoffene Fußball-Philosophen, rülpsen ihre Weisheiten über den Sport, den Alkohol und das Leben. „Die Bandscheibe“ (die großartige Franziska Mense-Moritz) widersetzt sich Jahr für Jahr renitent dem Nichtraucherschutz („Wo ich bin, is Raucherecke!“). Die „Hossa Boys“ intonieren mit heiligem Ernst Bierhymne um Bierhymne. Darin sind die „Geier“ um Regisseur Günter Rückert groß; das Ensemble besteht aus versierten und professionellen Kleinkünstlern, Musikern und Comedians, die auch alleine Abende bestreiten können.
Es sind jedoch die Nummern dazwischen, die den Geierabend zu dem machen, was er heute ist: ein relevantes Stück Gegenöffentlichkeit. In einer Zeit, in der ein schwuler Fußballer auf mehr Interesse stößt als Umwelt- oder Abhör-Skandale und in einer Region, die sich überwiegend schon an die Existenz nur einer Zeitung vor Ort gewöhnt hat, holt der Geierabend das Politische auf die Bühne öffentlicher Unterhaltung zurück. Das ist altmodisch, aber heute sogar wichtiger als zu Blütenzeiten des Kabaretts vor drei, vier Jahrzehnten.
Es ist vor allem eine Nummer, bei der einem Großteil des Publikums das Lachen im Halse stecken bleibt: „Eine Seefahrt vor Lampedusa“. In der bitterbösen Satire hat eine Familie eine Seefahrt mit besonderer Attraktion gebucht: Flüchtlinge gucken. Walfische standen schließlich schon im vergangenen Jahr auf dem Programm. „Die hab‘ ich mir viel schwärzer vorgestellt“, sinniert der Vater (Murat Kayi), während das Kind (Sandra Schmitz) quengelt: Es will die über Bord gegangenen Flüchtlinge füttern, am liebsten einen mitnehmen. „Füttern verboten! Du darfst eines herausholen, aber hinterher kommt es wieder ins Wasser!“, mahnt der Kapitän (Roman Henri Marczewski). „Wenn ein Neger vor Lampedusa im Meer versinkt…“, singen die Geier auf die Melodie von „Bella Bella Marie“. Wer sich traut zu lachen, hält plötzlich erschrocken inne.
Denn politisch korrekt sind wir Deutschen ja – keiner kann das besser beurteilen als „Osman und Yüksel“ (Hans-Peter Krüger, Murat Kayi). „Roma? Wer Sinti?“, fragt der einbürgerungswillige Türke seinen bereits erfolgreich integrierten, ja assimilierten Landsmann. Dieser erklärt seinem Kollegen, wie wichtig die korrekte Wortwahl ist – Eiche rustikal reiche nicht, um ein guter Deutscher zu werden. Was wiederum Unverständnis provoziert: Ayshe rustikal? Am Ende ist man sich einig: Die Deutschen bürgern Türken wohl vor allem aus einem Grund ein: Damit es wieder einen Türken in Deutschland weniger gibt.
Diese Botschaft kommt in der Nummer „Neujahrsansprache der Kanzlerin“ so zwar nicht vor – dafür wird diese aber gereimt und gesungen. Mense-Moritz ist ein wunderbares Mutti-Double, zurzeit originalgetreu auf Krücken. Und selbst mit denen kann frau die berühmte Raute machen.
Es geht um weiterhin um die NSA und den Luxus liebenden Bischof, das Ende der FDP und die Zukunft des Ruhrgebiets, vegane Ernährung, singende Sauerländer und fliegende Holländer. Doch das bislang heftigste Erregungspotential birgt zumindest den Reaktionen auf Facebook zufolge eine Homöopathie-Nummer: „Der Steiger“ (Martin Kaysh) schluckt Geierabend für Geierabend den Inhalt einer zufällig ausgewählten Flasche Globuli. Ein Menschenversuch auf der Bühne. Auf der Facebook-Seite des Steigers entbrannten bereits engagierte Diskussionen über wahlweise Sinn und Unsinn dieses Experiments sowie der Homöopathie.
Wie geht es heute, das richtige Leben, und wird es durch Homöopathie besser? Das sind Fragen, die die Menschen bewegen – zumindest dazu bewegen, sich zu Wort zu melden. Es wird wirklich Zeit für mehr gutes Kabarett.
Wer es drei Stunden lang eingeklemmt zwischen bestens aufgelegten Mitmenschen auf Bierbänken aushält, dem sei der Geierabend 2014 warm empfohlen.
(Offenlegung: Die Autorin verfasst ab und zu Pressetexte für den Geierabend. Für diesen Beitrag wird sie jedoch nicht bezahlt).