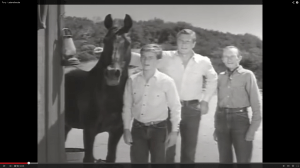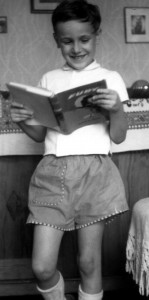Wer steckt eigentlich hinter dem „Oscar“?
Seit ich alljährlich meine persönlichen Gedanken zu den Oscar-Nominierungen niederschreibe, frage ich mich heute mal: „Who da fuck is Oscar“, obwohl das richtig heißen müsste, „Who da fuck is…“ diese ominöse „Academy of Motion Pictures“? Wer steckt dahinter? Kennt man die Leute? Sind das hoch dekorierte Aktricen und Akteure, Regisseure, Dekorateure, Requisiteure, Komponeure, Friseure, Couturiers, Make-up-Artisten, Drehbuchschreiber, Autoren, Kameraleute, Editoren, Cutter, Kabelträger, Besetzungsbüros, und andere Filmschaffende?
Oder gar Multimillionäre, Banker, Wheeler/Dealer, Money Traders, die Mafia vielleicht (an alle strenggläubigen Frauenrechtspersonen jeglichen Geschlechts: all diese Berufe auch für –innen, versteht sich von selbst)?
Ich hatte nie drüber nachgedacht.
Seit nun aber schon wieder so ein Mogelpaket mit Namen ADAC geplatzt ist und auch seit wir ja jetzt mit Gewissheit erkennen durften, dass dieser früher von vielen belächelte „Big Brother“ unser Leben nicht nur vollelektronisch überwacht, sondern auch steuert, hab ich mal ein bisschen recherchiert. Bei Wikipedia und Co. Da weiß man ja auch nicht immer, woher die Informationen kommen, ob sie komplett sind, und ob sie stimmen. Aber ich bin gutgläubig und nehm das jetzt alles mal als ziemlich wahr hin.
Ehrenamtlich und gemeinnützig
Ich wollte also wissen, wer genau die Bestimmer von Qualität und Leistung in der Illusionsfabrik Hollywood sind.
Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) wurde 1927 als eine ehrenamtliche und gemeinnützige Organisation gegründet. Das heißt soviel wie: Die kriegen keine Knete für ihr Schaffen. Die Gründungsmitglieder kommen tatsächlich aus den von mir vermuteten Bereichen und noch ein paar mehr. Aber mafiöse Verbindungen sind nicht dokumentiert (die werden sich hüten, so was an die Öffentlichkeit dringen zu lassen). Obwohl, da ging ja mal die Frankie „Old Blue Eyes“ Sinatra-Geschichte einer Mafia-Connection durch die bunten Blätter. Alles nur Gerüchte?
Die Mitglieder also arbeiten (immer noch) ehrenamtlich. Das ist vielleicht für einige der Weltstars ein Opfer, wo ich doch immer wieder lese, dass man in den Kreisen gern schon für einen kleinen Händeschüttler bezahlt werden möchte. Aber schließlich, was zählt, ist doch zuerst die Ehre, dann das Amtliche.
Angeschwollen auf über 6000 Akademie-Mitglieder
Aus den anfänglichen 36 Mitgliedern wurden dann in 86 Jahren über 6.000, darunter manche, deren Namen nur begrenzt bekannt waren und wurden. Mitglied wird man nur auf Einladung der AMPAS. Wer über die Jahre des Filmschaffens einen oder gar mehrere Oscars einsammelt, darf fest damit rechnen, in den erlauchten Kreis eingeladen zu werden.
Damit da nun nicht alles kreuz und quer und chaotisch durcheinander läuft, gibt’s natürlich eine Organisation wie im richtigen Leben mit Präsident(in), 1. bis 3. Vize-Präsidenten, Schatzmeister, Sekretariat und CEO, dessen oder deren Aufgabe sich mir nicht ganz erschließt. Aber auch in Lala-Land ist ein Verein ohne Geschäftsleitung nichts. Auch eine Non-profit-Gesellschaft braucht eine Sekretärin, und die bekommt hoffentlich trotz aller Ehrenamtlichkeit ein Gehalt.
Titel wie Vice President und CEO machen sich immer gut auf einer Visitenkarte bei einer Party oder bei einem Telefonat, auch wenn das eine finanzielle Luftnummer ist. Da hat man halt was Eigenes, wie ein Diplom oder einen Ehrendoktor, mit dem man Eindruck schinden kann. Namentlich in Erscheinung treten diese Herrschaften äußerst selten.
Es gibt unheimlich viel zu gucken
Nun also sitzen jährlich Tausende von ebendiesen Filmschaffenden zuhause rum und gucken Filme ohne Ende. Nebenbei werden sie ja auch noch selber mal hier und da ’ne Rolle übernehmen. Je nach Autor, Story und Regisseur kann das auch ne wochen-, monate- oder jahrelange Sache werden. Ob die sich dann nach einem anstrengenden Dreh abends noch in ihre Wohnwagen schleppen, um das Material für den nächsten Preisverleih zu sichten? Das ist nicht überliefert. Aber falls sie es tun, dann gab’s für die diesjährige Veranstaltung viel, viel zu gucken, denn einige der nominierten Werke sind tatsächlich 180 Minuten lang.
That’s a lot of viewing! Und sie bekommen dafür ja höchstens diese Beutelchen mit hochwertigen Sächelchen drin, die „Goody Bags“ (und die Ehre natürlich). Da ist Kram drin, die keiner der Hollywoodies braucht, aber nett zum verschenken an Freunde, Verwandte und Fans. Oder verscherbeln sie es bei Ebay? Eine Gucci-Sonnenbrille, die Uma Thurman mal angefasst hat, das bringt bestimmt was ein.
Mein Fazit also, da sie es alle nur für Krishnas (beliebig ersetzbar durch andere Gottfiguren) Lohn tun, hoffe ich auch, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen jurieren. Ganz sicher bin ich da ja nie.
Vielleicht sagt sich da auch mal die Eine oder der Andere: „Hach nee, die/den kann ich nicht ab, keine Stimme von mir, egal wie göttlich die/der da war“. Oder solche, die grad nen brandheißen Film zu verhökern haben, antichambrieren und verführen Stimmberechtigte mit Champagner in Jacuzzis, gefüllt mit lauwarmer Eselsmilch – und reichen dazu frittierte Elefantenhoden.
In 86 Jahren präsidierten nur drei Frauen
Erstaunlich finde ich, dass in den ganzen 86 Jahren nur drei Frauen Präsidentin der Akademie waren. Die erste war Bette Davis 1941. Nach zwei Monaten schmiss sie der Academy ihr Amt vor die Füße, da war sie 33. Offizieller Grund: zu viel Filmarbeit, um diesen Job ausfüllen zu können. Hinter vorgehaltener Hand entwichen allerdings die wahren Gründe, nämlich, dass sie stinksauer war, weil sie vermutete, dass sie nur als Pappkameradin, Quotenfrau quasi, ausgewählt worden war.
Dann folgten erst mal wieder Männer, von denen nur Gregory Peck zu Weltruhm kam. Fay Kanin musste bis 1979 warten, ihre Präsidentschaft dauerte vier Jahre. Wie im wirklichen amerikanischen Leben. Über Frau Kanin, die in Hollywood und der Filmbranche weltberühmt war, habe ich nicht viel erfahren können. Sie war nur einmal, mit Herrn Kanin, verheiratet und wurde 96 Jahre alt. Sie starb voriges Jahr.
Nun folgen ganz viele Männer, der bekannteste war Karl Malden. Erst voriges Jahr im Juli übernahm dann Cheryl Boone Isaacs. Sie ist African American und war bisher im Film-Marketing tätig. Sie hat die Marketing Kampagnen für „Forrest Gump“ geleitet, der ja dann einen Oscar für „Best Picture“ gewann. Wenn das keine Empfehlung für die Präsidentschaft ist! Wir werden sie dieses Jahr zur Eröffnung der Feierlichkeiten kennenlernen.
Auch wenn man den Eindruck gewinnen könnte, dass AMPAS eigentlich nur um sich selbst rotiert, stimmt das nicht. Sie unterstützen und fördern verschiedene Akademien rund um das Filmgeschäft. Sie vergeben Stipendien und gut dotierte Preise an Studenten und Schulen. Woher diese finanziellen Mittel kommen, konnte ich noch nicht rausfinden, wo doch alle Mitglieder ehrenamtlich arbeiten. Vielleicht fließt da Geld von den oben erwähnten Gönnern, Million-Dollar-Unternehmen und anderen Mäzenen.
Ein wenig eigener Senf muss sein
Noch in diesem Monat und vor der Übertragung der Oscar-Zeremonie (2. März) werde ich mich hier über einige Filme fürs diesjährige Event auslassen. Wie immer eine total subjektive Beurteilung, und ich ahne jetzt schon, dass Aufschreie durch die Reihen meiner Leser gehen werden.
Fünfeinhalb der neun nominierten Filme hab ich schon gesehen (manche davon durchlitten, besonders den halben). Da es meistens sehr lange Filme sind, muss ich sehen, dass ich mich kurz genug fasse, um alle wenigstens andeutungsweise zu würdigen. Und das dauert ja auch. Also, gedulden wir uns.
Leider bin ich ja nicht Mitglied in dieser ehrenwerten Organisation (das wär mein Traumjob, würd‘ ich glatt ohne Lohn, nur gegen Kost und Logis, machen), deshalb kann ich jetzt schon und ohne zweckorientierte Begleiterscheinungen meinen (bis jetzt) Lieblingsfilm für dieses Jahr nennen, der zwar nicht nominiert ist, dafür aber die leading (Cate Blanchett) und die supporting (Sally Hawkins) Lady: „Blue Jasmine“ von Woody Allen.
Noch diese Woche fange ich an, meinen Senf über diesen oder jenen nominierten Film zu breiten. Bis dahin: Hasta la vista, Baby.