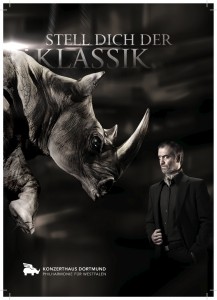„Erhalte die fünf französischen Opern, die ich komponiert habe, auf dem Repertoire aller Theater der Welt während meines ganzen Lebens, und ein halbes Jahrhundert hindurch nach meinem Tode.“ Was sich der Komponist Giacomo Meyerbeer in seinem „Täglichen Gebeth“ vom „großen Gott“ gewünscht hatte, ist im Lauf der Geschichte in fataler Weise eingetroffen und wirkt bis heute nach: Während sich im letzten Jahr zu den 200. Geburtstagen von Richard Wagner und Giuseppe Verdi der merkantil beschleunigte Reigen des sowieso Bekannten noch erhitzter drehte, bleibt es in diesem Jahr um den 150. Todestag des dritten und vielleicht wichtigsten Erfolgskomponisten des 19. Jahrhunderts still.
Alle großen Opernhäuser drücken sich um Meyerbeers monumentale Werke; selbst seine Heimatstadt und – neben Paris – wichtigste Wirkungsstätte Berlin schafft es gerade einmal, seine opéra comique „Dinorah“ aufzuführen, und das auch nur konzertant, aber immerhin als Auftakt eines Meyerbeer-Zyklus‘, während Daniel Barenboim als glamouröser medialer Protagonist des hauptstädtischen Musiklebens mit „Parsifal“ wieder einmal ein Wagner-Event auf den Markt wirft.
Auch das Dutzend der Musiktheater in Nordrhein-Westfalen nennt seit Jahren den Namen Meyerbeer nicht auf den Spielplänen. Wären nicht ein so passionierter Entdecker wie Peter Theiler in Gelsenkirchen Intendant gewesen, hätte es auch 2008 dort nicht „Die Afrikanerin“ gegeben. Sie war in NRW neben „Der Prophet“ 2004 am historischen Schauplatz in Münster und der Rarität „Dinorah“ in Dortmund (2000) unter John Dew die bisher jüngste Meyerbeer-Tat des neuen Jahrtausends.
Theiler sorgt am Staatstheater Nürnberg für den bisher einzigen Lichtblick in diesem Meyerbeer-Jahr: Dort haben „Les Huguenots“ am 15. Juni Premiere. Wer heute von einer „Renaissance“ spricht, weil es hier und da einmal eine Wiederaufführung gibt, verbreitet leider Zweck-Optimismus: Keines der großen Opernhäuser pflegt ein Meyerbeer-Repertoire, keines bietet eine kontinuierliche Arbeit mit seinen Werken an.
Günstige Voraussetzungen – aber keine Rezeption
Dabei sind die Voraussetzungen heute so günstig wie seit Meyerbeers überraschendem Tod am 2. Mai 1864 nicht mehr. Die alten nationalen und antisemitischen Vorurteile sollten den Blick nicht mehr verstellen. Forscher wie Gudrun und Heinz Becker oder Sabine Henze-Döhring und Sieghart Döhring – letztere Autoren einer brandneuen Meyerbeer-Biografie im Verlag C.H. Beck – haben Person und Werk historisch erschlossen. Die Opernhäuser könnten auf neu ediertes, kritisches Notenmaterial zurückgreifen.
Dirigenten wie Marc Minkowski („Les Huguenots“ in Brüssel 2011), Frank Beermann („L’Africaine“ unter dem von Meyerbeer vorgesehenen Titel „Vasco de Gama“ 2013 in Chemnitz) oder Enrico Calesso („L’Africaine“ in Würzburg 2011) haben die spezifischen Qualitäten der kompositorischen Großformen und der raffinierten Instrumentation erkannt und die willkürlichen, entstellenden Kürzungen der Vergangenheit rückgängig gemacht. Und musikalisch hervorragend gebildete Sänger eröffnen die Chance, die schwierigen Gesangspartien – auf deren Interpretation Meyerbeer allergrößten Wert gelegt hat – stilistisch ansprechend gestaltet zu hören.
Die Unlust der Regisseure?
Warum also kein Meyerbeer? Die Antwort muss wohl in einem Knoten aus nachwirkendem Vorurteil, Scheu vor dem Aufwand angesichts immer knapperer Mittel, Schielen auf die Auslastung und Unlust an der Herausforderung gesehen werden. In Deutschland und Österreich kommt noch hinzu, dass in den Theatern des Dritten Reiches der Jude Meyerbeer eine Unperson war und die Aufführungstradition auch deshalb abgebrochen ist.
Bernd Loebe etwa, Intendant der Frankfurter Oper und ohne Scheu vor ungewöhnlichen Werken auf dem Spielplan, macht das Problem auch an der fehlenden Identifikation mit Meyerbeers Werk fest: Er habe für „L’Africaine“ mehrfach Absagen von Regisseuren bekommen. Käme heute ein Regisseur mit einem tragfähigen Konzept für eine Inszenierung zu ihm, würde er nicht zögern, Meyerbeer in den Spielplan zu nehmen, sagte er auf Nachfrage in der Spielplan-Pressekonferenz seines Hauses.
Sollte Loebes Eindruck verallgemeinerbar sein, spräche das nicht für den Horizont der kreativen Szene: Meyerbeer Sujets sind hochpolitisch und bestürzend aktuell. Aber vielleicht eignen sie sich nicht als „Material“, das sich der eigenen Privatmythologie beugt: Das desaströse Scheitern von Hans Neuenfels an Meyerbeers „Le Prophète“ in Wien (1998) mag dafür sprechen.
Der Mensch – zerstört im Sog der Geschichte
Meyerbeers Werke sind nicht nur beachtenswert, weil sie weit über das 19. Jahrhundert hinaus die Operngeschichte beeinflusst haben. Für die Bühne wiedergewonnen, wären sie auch nicht nur „bedeutende Kunstereignisse und grandiose Unterhaltung“, wie Sabine Henze-Döhring und Sieghart Döhring schreiben. Gerade die fünf Opern, die Meyerbeer in seinem „Gebet“ meint, sind heute wieder bestürzend aktuell, wie einzelne gelungene Aufführungen der letzten Jahre beweisen. Es sind pessimistisch gestimmte Geschichtsdramen, in denen der einzelne Mensch in den zerstörerischen Sog von Ereignissen gerät, gegen die er sich kaum wehren, gegen die er aber seine persönliche Integrität – auch im Scheitern – bewahren kann.
Nach erfolgreichen Jahren in Italien begann mit „Robert le Diable“ 1831 Meyerbeers sensationelle Pariser Karriere; mit diesem – wie kaum ein anderes geschmähtem – Werk wurde er neben Gioacchino Rossini („Guillaume Tell“) und Daniel-François-Esprit Auber („La Muette de Portici“, 1828) zum Erfinder der „grand opéra“. „Les Huguenots“ (1836) und „Le Prophète“ (1849) festigten seinen Ruf, der mit der posthum uraufgeführten „L’Africaine“ (1865) noch einmal internationalen Widerhall finden sollte. Ohne diese Vorbilder hätte es keinen Verdi, keinen Wagner, aber auch keinen Gounod oder Massenet, nicht „Boris Godunow“ von Mussorgksy und nicht „Krieg und Frieden“ von Prokofjew gegeben.
Meyerbeers gewaltige Geschichtspanoramen sind oft auf ihren – zweifellos angezielten und in der Pariser Oper unabdingbaren – Schauwert reduziert worden. Wagner sprach in seinen antisemitischen Hetzschriften von „Wirkung ohne Ursache“ und verschleierte damit nicht nur, was er in seiner Karriere und seinem Werk – bis hin zum „Parsifal“ – dem diffamierten Kollegen verdankte. Der „Meister“ hat ebenso wie der unermüdlich polemisierende Robert Schumann nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass Meyerbeer die Tragödie einzelner Menschen mit einem resignativen Bild einer von zerstörerischen Kräften bestimmten Geschichte verbunden hat. Die Opern Meyerbeers wirken – so der Musikjournalist Frank Siebert – „wie die Kehrseite deutschromantischer Idealisierungen“.
Zu der in den Werken gespiegelten Geschichtsphilosophie gehört das Religiöse untrennbar dazu. In „Robert le Diable“ etwa geht es Meyerbeer um ein Menschheitsdrama vor metaphysischem Hintergrund, gefasst in die Bilderwelt einer mittelalterlicher Rittergeschichte. Um die Seele eines schwankenden Helden (Robert) streiten Himmel und Hölle mit den Mitteln von Täuschung und Gnade. Meyerbeer zeigt theologisch scharfsichtig, wie das Böse seine Realität in der Welt nur als Scheinexistenz aufrechterhalten kann: durch Projektion und lügnerische Phantome. Er wendet sich aber gegen ein billiges Schwarz-Weiß-Schema, indem er den negativen Protagonisten, Bertram, nicht dämonisiert, sondern ihm auch die Züge eines ehrlich liebenden Vaters gibt.
Meyerbeer setzt auf zu seiner Zeit schockierend drastische Mittel: Die Orgel auf der Theaterbühne ist ein musikalisches, der oft lächerlich gemachte Auftritt der wiederbelebten Nonnen ein szenisches: Dass sich in der „Auferstehung“ ihrer toten Körper die nachäffende Perversion des Bösen zeigt, ist in der Empörung und der späteren Verspottung dieser Szene meist übersehen worden. Doch nicht umsonst hat George Sand „Robert le Diable“ als „katholische“ Oper bezeichnet.
Abrechnung mit dem Missbrauch von Glaube und Religion
In „Les Huguenots“ thematisiert Meyerbeer, wie die Religion selbst in den zerstörerischen Sog der Geschichte gerät und ihren inneren Kern verliert. Meyerbeer gelingt im politisch-menschlichen Panorama der „Hugenotten“, den Chor als „Masse“ im modernen Sinn zu konzipieren: Menschen, die von Stimmungen und Ideologien getrieben, zu Gewalt und Vorurteil neigen, und ab einem gewissen Punkt der Entwicklung kaum mehr zu bremsen sind.
Noch radikaler rechnet Meyerbeer mit dem Missbrauch von Glauben und Religion in „Le Prophète“ ab: Vor der Kulisse der Wiedertäuferbewegung im westfälischen Münster – und wohl auch der Pariser Revolution von 1848 – schildert die Oper Aufstieg und Fall des Schankwirts Jean als Gallionsfigur einer revolutionär-religiösen Bewegung. Meyerbeer exponiert das politisch-soziale Elend in der Willkürherrschaft des Adligen Oberthal, idealisiert aber die religiös bemäntelte Revolution der Wiedertäufer in keiner Weise: Ihre Mittel sind Täuschung, Gewalt und Betrug; ihr „Glaube“ ist bloßes Mittel zum Zweck.
Der zum „Prophet“ gemachte Jean ist Täter und Opfer zugleich: eine typischer Meyerbeer’scher Charakter, der rücksichtslosen, zynischen Manipulation durch die Wiedertäufer hilflos ausgeliefert, der er sich am Ende nur noch durch Vernichtung und Selbstauslöschung entziehen kann. In dem Trio der Wiedertäufer gelingt Meyerbeer nicht nur eine infernalische „unheilige Dreieinigkeit“, sondern auch ein Soziogramm des Funktionierens manipulativer Macht von bestürzender Modernität.
Umso erstaunlicher ist, dass diese wegweisende Oper im heutigem Betrieb überhaupt nicht beachtet wird: Ist sie doch viel mehr als eine Geschichte über die tragische Unvereinbarkeit von Macht und Liebe. „Le Prophète“ mit dem schillernden Helden und der messerscharfen Analyse der Mechanismen von Macht und Manipulation, von Ideologie und kollektiver Illusion, ausgearbeitet mit „stupender Bildhaftigkeit und psychologischer Tiefenschärfe, die in nie gekannter Genauigkeit auch die Szene und den Darsteller mit einbezieht (Döhring), wäre eine Herausforderung für jedes Theater, dem es darum geht, epochale Werke als relevant für unsere Zeit zu entdecken.