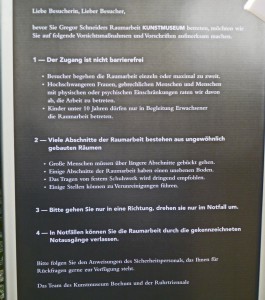Geld ist keine Ware, sondern ein System – die Thesen des Briten Felix Martin
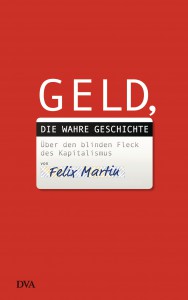 Was ist Geld? Diese Frage stellt der britische Wirtschaftswissenschafter Felix Martin. Die Antwort hingegen fällt landläufig anders aus, als er es sich wünscht. Martin, der früher Mitarbeiter der Weltbank war, ist der Ansicht, dass unsere herkömmliche Betrachtungsweise des Geldes im Kern falsch ist und hat die seiner Meinung nach wahre Biographie des Geldes aufgeschrieben.
Was ist Geld? Diese Frage stellt der britische Wirtschaftswissenschafter Felix Martin. Die Antwort hingegen fällt landläufig anders aus, als er es sich wünscht. Martin, der früher Mitarbeiter der Weltbank war, ist der Ansicht, dass unsere herkömmliche Betrachtungsweise des Geldes im Kern falsch ist und hat die seiner Meinung nach wahre Biographie des Geldes aufgeschrieben.
Die weitverbreitete Ansicht und herkömmliche Definition von Geld sei die von Geld als Ware respektive als Tauschmittel. Dies sei von Grund auf ein Irrglaube und somit zum Beispiel auch die Ursache der jüngsten Finanzkrise. Nach Felix Martin ist Geld keine Ware, sondern ein Kredit-und Verrechnungssystem. Wobei ein Schuldschein erst dann zu Geld wird, wenn es die Möglichkeit einer Übertragung gibt. Die Entdeckung, dass eine Verbindlichkeit eine verkäufliches Gut ist, sei d e r entscheidende Entwicklungsschritt in der Geschichte der Menschheit gewesen, sozusagen die Urmutter aller Revolutionen.
Diese Kernthese untermauert Felix Martin mit durchaus unterhaltsamen Erzählungen quer durch die ganze Weltgeschichte. Er beginnt mit den Einwohnern der fernen Pazifikinsel Yap, deren Einwohner ohne jeden Kontakt zur Außenwelt ein funktionierendes Währungssystem aufbauten, basierend auf nur wenigen unbeweglichen massiven Steinscheiben. Er berichtet von den Kaufleuten des Mittelalters, die ein grenzüberschreitendes Schuldschein-System aufbauten und von ihren neuzeitlichen Nachfolgern. Sie alle verbinde der Wunsch nach einem Utopia, in dem immer genug Geld für alle gerecht verteilt wird. Die hingegen erfolgte Freigabe der Märkte nennt er die „große monetäre Übereinkunft“ und führt diese auf den britischen Philosophen John Locke zurück, der der Menschheit den Irrglauben vom Geld als Tauschmittel gegeben hat – weil dieser am ehesten mit der politischen Philosophie der modernen Demokratie in Übereinkunft zu bringen war.
Es sind zum Teil witzige Geschichten, die er erzählt, Begebenheiten, die durchaus zum Nachdenken anregen und nicht ungeeignet sind, den Blick auf „unser“ Geld, das derzeitige Wirtschaftssystem zu ändern und in Frage zu stellen. Die Geschichten sind gut recherchiert und Felix Martin versteht es, sie anschaulich zu erzählen. Woran das Buch krankt, sind die über 300 Seiten immer wieder angekündigten Schlussfolgerungen. Ist er in der Erzählung der monetären Biographie noch radikal und kompromisslos, wird Martin in seinen am Schluss des Buches aufgestellten Forderungen nicht nur sehr zurückhaltend, sondern auch vage und gelegentlich widersprüchlich.
Mal fordert er, dass der Finanzsektor den Wert des Geldes nur messen und ihn nicht beeinflussen soll. Dann wiederum soll der Finanzsektor nicht nur messen, sondern auch maßgeblich an der monetären Organisation der Gesellschaft beteiligt werden. Oder vielleicht sollte doch besser die Politik eingreifen, denn Geld sei keine Sache, sondern eine soziale Technologie, dessen Standard politische Gerechtigkeit sein muss. Nur wie die Politik das regeln soll, das muss ihr schon selbst einfallen. Zentrale Regulierungsbanken tun es nach Felix Martins Auffassng jedenfalls nicht.
Ebenfalls irritierend sind seine Ausführungen zur Inflation. Inflation sei nach der These der Geld-Konzeption von z.B. John Maynard Keynes – dessen Lehren seiner Meinung nach nicht genug Beachtung erfahren – ein geeignetes Mittel, um „Kapitalisten zu schröpfen und Massen zu entlasten“. Diese These als gewagt zu bezeichnen, ist noch vorsichtig ausgedrückt. Die jüngste Finanzkrise habe bewiesen, dass es ein schwerer Fehler gewesen sei, „eine stabile, niedrige Inflationsrate als hinreichende Bedingung ökonomischer Stabilität zu betrachten“. Aha. Den Beweis dafür allerdings führt er nicht. Nur weil die Krise mit einer stabilen Inflationsrate zusammenfiel, war diese ja noch nicht zwangsläufig schuld dran. (Wenn man Sonnenbrand bekommt, ist auch nicht die Sonne schuld, sondern der Umgang der Sonnenanbeter damit.)
Natürlich können sich Staaten über eine höhere Inflationsrate entschulden, die USA haben es zu Zeiten der „Reaganomics“ glänzend vorgemacht. Und auch die EU-Staaten, allen voran Deutschland, kommen in diesem Bestreben ganz prächtig voran. Nur – wo bitte ist und war die von Keynes und in Folge Felix Martin damit verbundene angebliche Entlastung der Massen? Ist eine höhere Inflation nicht eher verbunden mit unauffälliger Enteignung? Nach Felix Martin wird die Entlastung schon irgendwann kommen. Fein. Bleibt die Frage: Wann genau ist irgendwann und welche Masse soll diesen Glauben teilen?
Was in diesem Buch komplett fehlt, ist die Währung neben der Währung: der Zins. Wenn er diesen für nicht erwähnenswert hält, dann müsste er auch so konsequent sein, direkt der kompletten staatlichen Regulierung das Wort zu reden. Aber das tut er nicht, möglicherweise hat er diesen Preis des Geldes gar nicht in Betracht gezogen. Nur – bei aller Liebe zur politischen Gerechtigkeit: Menschen, die mit Geld arbeiten, sind und bleiben Kaufleute und keine Philanthropen.
Letzten Endes bleibt als Martins geforderte Konsequenz lediglich die Bitte, seine Thesen über die Geschichte des Geldes zu zu verbreiten, an den Unis auch die Thesen verkannter Genies wie Keynes zu lehren sowie der wohlgemeinte Ratschlag, dass sich jeder etwas mehr für sein Geld verantwortlich fühlen sollte. Bisschen wenig dafür, dass über die gesamte Länge des Buches weltbewegende Schlussfolgerungen angekündigt werden. Man kann während der Lektüre nicht umhin, sich eine Christine Lagarde (Chefin des IWF) vorzustellen, wie sie genervt dieses Buch auf den Stapel „bringt mich jetzt auch nicht weiter“ legt. Wobei Madame Lagarde zur Zeit ohnehin andere Sorgen hat.
Die Analyse der Geldgeschichte von der Muschel über das Edelmetall bis zum Schuldschein ist recht profund, seine eigenen Thesen sind eher handzahm bis schwammig Wer unterhaltsam etwas über die Geschichte des Geldes lernen möchte, ist mit diesem Buch gut bedient. Wer Lösungsvorschläge sucht, eher nicht.
Fazit: Das Buch hält, was der Titel verspricht: Geld – die wahre Geschichte. Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Den Untertitel „über den blinden Fleck des Kapitalismus“ hätte man sich getrost und gerne sparen können.
Felix Martin: „Geld – die wahre Geschichte“. Deutsche Verlags-Anstalt (DVA), München, 432 Seiten, € 22,99.
- Der Buchautor Felix Martin ist studierter Wirtschaftswissenschaftler und Altphilologe.
- Neben seiner Arbeit bei der Weltbank gehörte er auch zur Denkfabrik European Stability Initiative.
- Heute ist er Mitarbeiter am Institute for New Economic Thinking und Anlageberater.
- Journalistisch tätig ist er unter anderem bei der Financial Times.