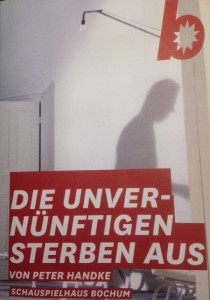Metropolensound: Triennale zeigt „Surrogate Cities“ als Choreographie für das Ruhrgebiet

Grundschüler aus dem Ruhrgebiet tanzen zur Musik von Heiner Goebbels (Foto: Wonge Bergmann/Ruhrtriennale)
Mal begegnet sie uns als belebende Metropole, mal als verschlingender Moloch. Die Stadt moderner Prägung ist Ballungsraum und Schmelztiegel, Brennpunkt und Sehnsuchtsort, der Menschen gleichermaßen vereint wie vereinzelt. Ungezählte Fotografen, Maler, Autoren und Dichter ließen sich von ihr inspirieren. Aber lässt sich urbanes Leben auch in Töne fassen?
Vor nunmehr zwanzig Jahren unternahm der Komponist Heiner Goebbels einen Versuch. Die Alte Oper Frankfurt hatte ihn beauftragt, ein Stück zur Feier des 700-jährigen Bestehens der Mainmetropole zu schreiben. So entstand sein Orchesterzyklus „Surrogate Cities“, der seit seiner Uraufführung am 31. August 1994 internationale Erfolge feiern konnte. Die Ruhrtriennale zeigt das Werk jetzt in einer erfrischend neuen Version der französischen Choreographin Mathilde Monnier.
Die Besetzung wird kundigen Konzertbesuchern bekannt vorkommen: Führten die Bochumer Symphoniker unter dem Dirigat von Steven Sloane das Werk doch bereits 1999 in der Bochumer Jahrhunderthalle auf. Damals wie heute waren der Stimmkünstler David Moss und die New Yorker Soul- und Jazz-Sängerin Jocelyn B. Smith als Solisten zu erleben. Deshalb von einem choreographierten Wiederaufguss zu sprechen, wäre gleichwohl falsch, ja nachgerade unfair.
Mathilde Monnier ist es mit bemerkenswert geschickter Hand gelungen, 130 höchst unterschiedliche Amateure aus der Ruhr-Region in die Produktion einzubinden. Grundschulkinder, Kampfsportler, jugendliche Hip-Hopper und ältere Menschen aus einer Gesellschaftstanzgruppe bewegen sich um ein Rund, in dem das elektronisch verstärkte Orchester musiziert. Von Lautsprechern und Bildschirmen umgeben, wirken die Musiker im monumentalen, rund 160 Meter langen Raum der Kraftzentrale als kraft- und taktgebender Nucleus. Das Publikum darf auf zwei Tribünen Platz nehmen, die an den schmalen Seiten der Halle aufgebaut sind.
Monniers einfühlsame Kunst besteht darin, Massenbewegung und Gruppendynamik zu inszenieren, ohne den Einzelnen in ein uniformes Glied zu zwingen. Individuelle Stärken und Schwächen werden sichtbar: Aber Monnier stellt niemanden zur Schau. Unperfektes, das anfangs „nur“ charmant erscheinen mag, entwickelt sie zu immer größerer Stärke, ja zur conditio humana. Nie verliert die Französin dabei die Verbindung zu Goebbels kraftvoller Musik, die sich mit Einflüssen aller Art vollgesogen hat, ohne darüber ihre Eigenständigkeit zu verlieren. Im Dialog mit einem elektronischen Sampler entsteht ein Sound, der weniger als Surrogat denn als globale Essenz der Stadt verstanden werden kann.

Heiner Goebbels beschließt in diesen Tagen seine dreijährige Intendanz (Foto: Wonge Bergmann/Ruhrtriennale)
Mit unerbittlicher Präzision betreiben die Bochumer Symphoniker unter Steven Sloane eine musikalische Kernschmelze. Wie unter Druck verflüssigt, fließt Neues und Bekanntes ineinander. Soul, Jazz und Funk mischen sich mit klassischer Moderne. Wild vorwärts treibende Rhythmik mündet in das poetische Fragment einer Scarlatti-Sonate. Was wie eine bloße Collage oder eine krude Mixtur klingen könnte, schmiedet Heiner Goebbels zu einem neuartigen Sound, der keine Grenzen mehr kennt. Texte von Paul Auster und Hugo Hamilton sowie drei Horatier-Songs von Heiner Müller erzählen von Kampf und Freiheit, von Einsamkeit und Lebenshunger. Stimmakrobat David Moss und die durchschlagskräftige Soul-Röhre von Jocelyn B. Smith erfüllen diese Fragmente mit Leben.

Die New Yorker Soul- und Jazz-Sängerin Jocelyn B. Smith singt „Drei Horatier-Songs“ nach Texten von Heiner Müller (Foto: Wonge Bergmann/Ruhrtriennale)
Goebbels Musik erhält durch die Choreographie von Mathilde Monnier eine hervorragende Unterstützung. Zwar leistet sie weit mehr als eine bloße Visualisierung der Musik, folgt ihrem Duktus aber doch mit einer Hingabe, die das Verständnis der Partitur und ihrer Strukturen erleichtert. Die Vorstellung endet unter Stürmen der Begeisterung. Sogar ein Hauch von Volksfest-Stimmung kommt auf, wenn Jung und Alt schließlich heimwärts streben. Mit „Surrogate Cities Ruhr“ verleiht Heiner Goebbels seiner dreijährigen Triennale-Intendanz einen bemerkenswert vitalen, unbedingt sehens- und hörenswerten Schlusspunkt.
Weitere Aufführungstermine: 26. und 27. September 2014. Informationen: http://www.ruhrtriennale.de/de/programm/produktionen/heiner-goebbels-mathilde-monnier-surrogate-cities-ruhr/
(Der Text ist zuerst im Westfälischen Anzeiger erschienen.)