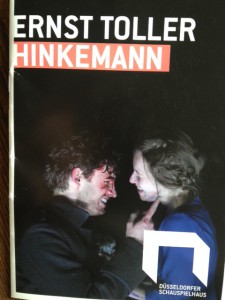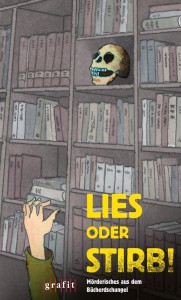Klug und beschwingt: „Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“ in Bochum

Hier droht ein Nervenzusammenbruch. Szene mit (v.l.) Sabine Osthoff (Candela), Anna Döing (Marisa), Bettina Engelhardt (Pepa) und Matthias Eberle (Carlos). Im Hintergrund Katharina Linder (Lucia). (Foto: Diana Küster/Schauspielhaus Bochum)
Der langjährige Lebenspartner hat sich per Anrufbeantworter verabschiedet und das gemeinsame Apartment verlassen. Außerdem stellt sich heraus, dass er vorher verheiratet war und Vater ist. Und die Neue ist die Anwältin seiner Ex und nach eigenem Bekunden Feministin. Hemmungslos nutzt Iván, dieser Lump, die Frauen aus, mit ein paar belanglosen Worten – „Blablabla“ – bricht er scheinbar Mal für Mal mühelos ihren Willen.
Das wäre in Kürze die Grundkonstellation des Stücks, einer Beziehungskomödie ganz offenbar mit Neigungen zum politisch Unkorrekten und zu gewissen Schlüpfrigkeiten. Oder doch eher eine Tragödie? Gegeben wird im Bochumer Schauspielhaus das Musical „Frauen am Rande des Nervenbruchs“ nach dem gleichnamigen Film von Pedro Almodóvar aus dem Jahr 1987.
Wie dem spanischen Filmemacher, so ist auch Regisseurin Barbara Hauck vor kräftigen Klischees nicht bange. Den Hauptpersonen begegnen wir deshalb gleich zu Beginn natürlich beim Friseur, wo sie unter Trockenhauben sitzend bunte Magazine lesen und geziert Espresso trinken. Lucía (Katharina Linder), Candela (Sabine Osthoff) und Marisa (Anna Döing) entsprechen den gängigen Weibchen-Mustern voll und ganz, wackeln beim Gehen heftig mit dem Hintern und tratschen alles in Grund und Boden.
Pepa (Bettina Engelhardt), die aktuell Verlassene, lernen wir ein wenig später kennen, wenn sie das gemeinsame Apartment (weiter hinten, weiter oben auf der Bühne) verlassen vorfindet. Und an wieder anderer Stelle sehen wir bald schon das junges Paar Marisa und Carlos (Matthias Eberle), das endlich eine eigene Wohnung haben will und deshalb seine „klammernde“ Mutter (Lucía) samt gemeinsamer Wohnstätte loswerden muss.

Stefan Hartmann (Ambite), Katharina Linder (Lucia), Bettina Engelhardt (Pepa), Lou Zöllkau (Ana Cristina), Nicola Mastroberardino (Taxifahrer). (Foto: Diana Küster/Schauspielhaus Bochum)
Die häufigen Wechsel der Handlungsstränge und Spielorte bewältigt diese Inszenierung mit einem Bühnenbild aus Plattformen, die sich nach Bedarf heben und senken und auf denen die Szenen spielen. Treppen verbinden sie (Bühne: Mara Henni Klimek).
Auch die Musiker sitzen auf einer Plattform und verschwinden deshalb ab und zu im Untergrund. Requisiten schweben bei Bedarf vom Schnürboden herab, Telefonhörer vor allem, zudem Verkehrsschilder und Ampeln, wenn als Spielort die Stadt Madrid gemeint ist. Dann kommt auch einige Male der launige Taxifahrer (Nicola Mastroberardino) ins Spiel, ein großer Kundinnenversteher mit gut sortiertem Notfallsortiment.
Das Auf und Ab der Ebenen strukturiert die aufgekratzte Handlung sinnvoll, ohne deshalb dem Tempo zu schaden. Einige Male ergeben sich dabei zudem so erstaunliche Perspektivwechsel, dass man vermeint, dreidimensionalen Kamerafahrten beizuwohnen.
Kinofilme auf die Theaterbühne zu bringen, ist in den letzten Jahren Mode geworden, die Qualität der Resultate schwankt. Diese „Frauen am Rande des Nervenbruchs“ allerdings wurden nicht in Bochum adaptiert, sondern stammen von den Amerikanern Jeffrey Lane (Buch) und David Yazbek (Musik und Liedtexte). Sie machten aus Almodóvars Film ein veritables Broadway-Musical, das 2010 in New York seine Uraufführung erlebte. Deutschsprachige Erstaufführung war 2012 in Graz. Aber natürlich verleugnet dieses Bühnenstück seine filmische Vorlage keineswegs, und in Bochum pointiert es sie sogar.
Der weltweite Erfolg von Amodóvars wahrscheinlich bedeutendstem Film liegt gewiss weniger im Gang der Handlung als in einer ungewöhnlichen Empathie und im Perspektivwechsel. Almodóvar hält zu den Frauen, zu allen, die hier vorkommen, er spielt sie nicht dramaturgisch gegeneinander aus. Und er zeigt, dass sie nicht wehrlos sind.
Wahrscheinlich stimmt es ja, dass das treulose und zynische Gebaren Iváns (Michael Schütz) sie eher an den Rand des Nervenzusammenbruchs als zum Griff nach dem Revolver treibt. Doch einerseits, das demonstriert die in die Handlung eingebaute Terroristenfahndung mit schusswaffenfuchtelnden Fahnderdeppen, wären Pistolen wohl auch keine Lösung. Andererseits entwickeln die von Iván betrogenen Frauen schließlich doch ein gewisses gemeinsames Selbstverständnis, aus dem Stärke erwächst, ein zartes Pflänzlein, für das das Wort Solidarität noch zu stark wäre. Aber immerhin.
Die Gesangsdarbietungen vermögen nur begrenzt zu überzeugen. Trotz Mikroports bleibt viel Text unverständlich, und angesiedelt irgendwo zwischen 60er-Jahre-Kino und Webber-Musical strotzen die Melodien nicht unbedingt vor Originalität. Immerhin jedoch singen Bochumer Theaterschauspieler besser als viele Kollegen anderer Revierbühnen.
Musiziert indes wird exzellent von einer (offenbar namenlosen) siebenköpfigen Kombo unter der Leitung von Tobias Cosler. Sie bringt eindrucksvoll auch die Ouvertüren vor und nach der Pause zu Gehör, die mit ihren manchmal schrillen Tönen auf moderat swingender Unterlage an das Weillsche Intro zur Dreigroschenoper denken lassen, die – ein Zufall? – sich dem Motiv der sexuellen Hörigkeit kaum weniger hingebungsvoll widmete als nun das Bochumer Almodóvar-Musical.
Anders als zum Beispiel Dortmund wählt Bochum zum Spielzeit-Auftakt die sichere Seite und verzichtet auf inszenatorische Experimente. Das ist nicht verwerflich. Diese „Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“ kommen erfrischend leicht daher, sind unterhaltsam, ohne seicht zu werden. Die gleichermaßen kluge wie beschwingte Einrichtung des Stoffs blendet tragische Valeurs keineswegs aus, ohne jedoch dem Publikum die Freude am Theaterbesuch zu nehmen. Wenn Pedro Almodóvar im Parkett gesessen hätte, wäre er wohl zufrieden gewesen.
Nächste Termine: 1. und 19. Oktober, 21. und 22. November 2014
http://www.schauspielhausbochum.de/spielplan/frauen-am-rande-des-nervenzusammenbruchs/