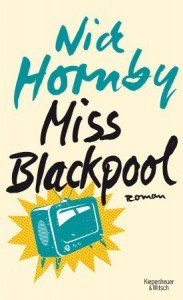Udo Jürgens lebt nicht mehr – doch so vieles klingt noch nach

Udo Jürgens singt „Siebzehn Jahr‘, blondes Haar“… (Screenshot aus: https://www.youtube.com/watch?v=2-g7bDHHEnA)
Irgendwie teilten wir uns allerlei im Leben. Obwohl er mir stets mit 15 Jahre voraus ging. Obwohl er „meine Musik“ nie machte, mochte ich vieles von dem, was er mit seiner Musik verbreiten wollte.
Udo Jürgens, der ewig jugendliche Musikant, der als Udo Jürgen Bockelmann zur Welt kam, der Mann, den ein glühender Antifaschismus befeuerte, der „sich für die Schweiz schämte“, als deren Bürger sich Anfang des Jahres 2014 mit knapper Mehrheit für die Vorstellungen der Eidgenössischen Volksinitiative „Gegen Masseneinwanderung“ aussprachen, er starb jetzt, am 21. Dezember des selben Jahres: Im Alter von 80 Jahren wollte sein Herz nicht mehr schlagen.
Ich höre noch, wie Robert Lembke ihn grantelnd fragte, nachdem das Schweinderl schwerer geworden war und der Ratetrupp Udo Jürgens Namen lauthals ins Studio posaunt hatte: Er möge ihm doch verraten, warum er diese entsetzlich langen Haare trüge, er sei doch sonst ein richtig netter Kerl. Udo begann freundlich und geduldig dem älteren Robert zu erläutern, dass es nun mal Mode der Zeit sei und es ihm zudem wirklich gefiele. Er konnte Lembke nicht nachhaltig überzeugen, aber für einen netten Kerl hielt er ihn doch.
Ich höre noch, wie er zum ungeteilten Entzücken des Publikums in der Theateraula zu Kamen „Siebzehn Jahr‘, blondes Haar“ schmetterte und ich in einem Ausbruch von Leidenschaft den Takt mit dem rechten Fuß stampfte. Zurück in der Redaktion tippte ich als erstes die Überschrift: „Spät kam er nach Kamen, aber er kam und kam nicht zu spät“. Tags drauf maulte mein damaliger Chef Günter Schaumann, dass in Überschriften Satzzeichen nichts zu suchen hätten. Er sollte in den folgenden Jahren nicht der Letzte sein, der sich darüber mokierte.
Ich höre noch, wie es an meinem 50. Geburtstag aus den Disko-Lautsprechern bedauernd scholl: „Ich war noch niemals in New York …“ Noch ahnte ich nicht, dass ich ein paar Stunden später genau dorthin abheben sollte.
Ich höre noch Bing Crosby, wie er für den Titel „Come Share the Wine“ bejubelt wurde, der als „Griechischer Wein“ europäische Charts in Serie stürmte und den damaligen Oberhellenen Karamanlis bewegte, Udo Jürgens und seinen Texter Michael Kunze mit rotem Teppich zu empfangen, weil sie so schön emotional gespiegelt hätten, was Gastarbeiter aus ihrer Heimat in deutscher Ferne so bewegte.
Ich höre noch das „Ehrenwerte Haus“ oder „Rot blüht der Mohn“, nur zwei Beispiel-Melodien dafür, dass Udo Jürgens und seine Texter (u.a. Eckart Hachfeld) Politik und gesellschaftliche Probleme nicht aus ihrer Form der populären Musik heraushalten wollten.
Und ich höre noch heute gern „Viel Dank für die Blumen“, das Lied, das eine jede Folge „Tom und Jerry“ einleitete und dessen unübertroffene Fröhlichkeit das vorweg nahm, was kurz darauf an einem Feuerwerk des gezeichneten Slapsticks abgebrannt wurde.
Der unverwüstlich wirkende Udo Jürgens, dessen Bruder Manfred ein ungemein begabter Fotograf war, zu dessen Familie mütterlicherseits der Dadaist Hans Arp zählte, der mehr als 1000 Titel schrieb und gleich mehrere Generationen in seinen Bann zog; nun ist sein schöpferisches Leben beendet. Und vor wenigen Wochen schrieb mein Freund Lars Reckermann noch, wie sehr es sich gelohnt habe, sein letztes Konzert in diesem Jahr besucht zu haben.
_________________________________________________________________________
Für die Revierpassagen hat Britta Langhoff im November eines der letzten Konzerte von Udo Jürgens besucht – in Oberhausen.