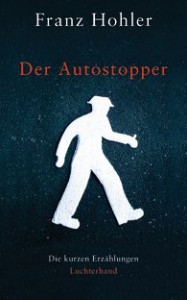Bedrohlich flackernder Faschismus: Dortmunder „Tatort“ zur Neonazi-Szene
Das dürfte jetzt feststehen: Dortmund ist – glaubt man den Fernsehbildern – derzeit die abgefuckteste und desolateste „Tatort“-Stadt. Doch zugleich entstehen hier mit die stärksten und dringlichsten Krimis der Reihe.
Der heutige Fall (Untertitel: „Hydra“) rankte sich um den Mord an einem stadtbekannten Rechtsradikalen, somit auch um die örtliche Neonazi-Szene und deren fatale Querverbindungen ins Polizeipräsidium und zu anderen staatlichen Stellen.

Kommissar Faber (Jörg Hartmann, li.) befragt im früheren Stahlwerk einen Obdachlosen (Michael Witte). (Foto: WDR/Thomas Kost)
Im Kern ging es nicht zuletzt um die latente oder gar manifeste Nähe des Faschismus zur so genannten „Normalität“ und Alltäglichkeit. Springerstiefel und Baseballschläger sind nur ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit. Man muss viel genauer hinsehen. Eben dies versuchte dieser „Tatort“ auf beklemmende Weise. Sichtbar wie Wunden wurden einige flackernde Ambilvalenzen und Widersprüche des Themas.
Dabei kamen etliche, vielfach mehrdeutige Nuancen in den Blick: Ein Anfangsverdacht richtete sich gegen eine Antifa-Beraterin jüdischen Glaubens. Ein Rechtsextremer zeigte sich juristisch und sprachlich gewieft. Einige Fußball-„Fans“ bewegten sich in bedenklichen Grauzonenen oder übleren Gefilden. Und immer wieder dieses gleichgültige Wegsehen…
All das drohte bisweilen unübersichtlich zu werden – ganz wie im richtigen Leben. Fast nichts wurde ausgespart, also blieb den Zuschauern kaum etwas erspart; auch nicht der feige, demütigende Überfall auf die deutsch-türkische Polizistin Dalay (Aylin Tezel).
Natürlich war das Ganze dramaturgisch modelliert, doch es bewegte sich überwiegend wohl auch verflucht nah an der Realität.
Kommissar Faber (Jörg Hartmann) hat sich unterdessen längst zur Fachkraft für allerlei Abgründigkeiten entwickelt, er genießt eine Art Autorität bei allen Verzweifelten, bei „denen da unten“. Er selbst ist ja so eine arme Seele.
Man kann es nur mit drastischen Worten sagen: Ansonsten bleibt Faber der Kotzbrocken (wahlweise: das Arschloch), dem auch und gerade die Kolleg(inn)en am liebsten mal die Fresse polieren würden. In seiner Abteilung herrscht ein Scheißklima. Doch gerade, weil sie sich keinerlei Illusionen machen, sind sie dem Verbrechen ebenbürtig. Mindestens.