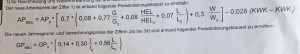Demnächst vor der Bochumer Jahrhunderthalle: Die Bikinibar aus dem Atelier Van Lieshout (Foto: Ruhrtriennale)
Johan Simons ist, wie bekannt, für die nächsten drei Jahre Intendant der Ruhrtriennale, und heute hat er sein Programm 2015 präsentiert. Erster Eindruck: Es kommt drauf an, was man draus macht, oder auch: Schau’n mer mal. Der Chef selbst ist da nicht so zögerlich. „Seid umschlungen!“ ist das euphorische Motto dieses „Festivals der Künste“ (Untertitel), das programmatisch sehr gern in den Schöpfungs- und Erlösungsmythen der Menschheit gründelt.
Die richtig großen Namen, das, was man im Showgeschäft „eine sichere Bank“ nennen könnte, fehlen weithin. Der Regisseur Luk Perceval und die Choreographin Anne Teresa De Keersmaeker sind vielleicht noch am ehesten Namen, die einer etwas breiteren Kulturöffentlichkeit bekannt sein könnten, wiewohl natürlich auch viele andere Auftretende ihre mehr oder minder große Fangemeinde haben werden.
In diesem Programm vermengt Klassik sich mit Pop und Zwölftönerei, um im nächsten Schritt auch noch elektronisch verfremdet zu werden, dort löst sich die Oper in eine Rauminstallation auf, und wenn schon nicht atemberaubend Crossovermäßiges auf die Spielstatt gestellt wird, dann sind zumindest doch Sprachenkenntnisse hilfreich, um fremdsprachige Schauspieltexte verstehen zu können. Immerhin sind deutsche Untertitel versprochen.

Ruhrtriennale-Intendant Johan Simons (Foto: Stephan Glagla)
Johan Simons selbst, der das Theaterspielen auf der Straße begann, sich und seinen robusten Inszenierungsstil mit „Sentimenti“ bei der Ruhrtriennale früh schon unvergeßlich machte und selbst einen Stoff von Elfriede Jelinek noch als Burleske zu inszenieren wußte („Winterreise“, 2011 an den Münchner Kammerspielen), gibt jetzt den seriösen Einrichter bedeutungsschwerer Musikstoffe, inszeniert im September in der Jahrhunderthalle Wagners „Rheingold“, nachdem er schon Mitte August eine Bühnenfassung des Pasolini-Films „Accattone“ mit Musik von Johann Sebastian Bach auf die Bühne der Kohlenmischhalle Zeche Lohberg in Dinslaken zu stellen beabsichtigt.

Nicht unbedingt ein Ausbund an Schönheit, trotzdem in diesem Jahr ein Spielort der Ruhrtriennale ist die Kohlenmischhalle der Zeche Lohberg in Dinslaken (Foto: Ruhrtriennale)
Die Zeche Lohberg übrigens ist neu im Strauß der Spielorte, der generösen Ruhrkohle-AG – bzw. deren mit anderen Großbuchstaben firmierenden Rechtsnachfolgerin – sei Dank. Hingegen, um auch das noch los zu werden, bleibt Dortmund wieder außen vor. Letztes Jahr noch war zu hören, daß die neue Triennale-Leitung auch Interesse an der berühmten Jugendstil-Maschinenhalle der Museumszeche „Zollern“ in Dortmund-Bövinghausen gezeigt hätte. Doch es ist wohl nichts daraus geworden. Statt dessen, neben den „Haupt-Städten“ des Festivals (Bochum, Duisburg, Essen und Gladbeck) nun also Dinslaken. Voilà!
Auffällig viele Niederländer (und Belgier) bevölkern das neue Triennale-Programm. Doch ist dies letztlich nicht zu geißeln, da ein Intendant natürlich alle Freiheiten hat, Kunst und Künstler zu bestimmen. Für den Vorplatz der Jahrhunderthalle ist seine Wahl auf das „Atelier Van Lieshout“ gefallen, das hier rund um eine bespielbare Gebäudeskulptur mit Namen „Refectorium“ ein Dorf entstehen lassen will, in dem es ein „BarRectum“, einen „Domesticator“, eine „Bikinibar“ oder auch ein „Workshop for Weapons and Bombs“ geben soll. „The Good, the Bad and the Ugly“ ist das Projekt überschrieben. Was kommt da auf uns zu? Geistige Auseinandersetzung natürlich, hier, laut Ankündigung, mit Selbstbestimmung und Macht, Autarkie und Anarchie, Politik und Sex.

Hier gibt es bald wieder Theater: Gebläsehalle Duisburg-Nord (Foto: Ruhrtriennale)
Schauen wir ein wenig durch das Programm, das sich (unter anderem) auf einem sehr ordentlichen, nach Spielstätte und Datum ordnenden Kalender abgedruckt findet. Den Reigen der „großen“ Produktionen eröffnet, wie schon erwähnt, am 14. August die musikalische Pasolini-Adaption „Accattone“ in Dinslaken. Sie wird sechsmal gezeigt – und mehr findet in Dinslaken dann auch nicht statt.
In Bochum steigt am 15. August die Eröffnungsparty mit dem Namen „Ritournelle“, und da geht es dann hübsch popmusikalisch zu, wenn nicht gerade Neue Musik von Karlheinz Stockhausen zum Vortrag gelangt, entweder das Frühwerk „Gesang der Jünglinge“ oder das Spätwerk „Cosmic Pulses“. Bißchen Namedropping für die, die etwas damit anfangen können: Das Berliner Plattenlabel City Slang, das seit 25 Jahren besteht, spielt eine Rolle und ebenso die Gruppe „Notwist“. Es wird bestimmt laut und lustig, doch danach auch ganz ruhig.
Lediglich zwei Auftritte des Collegium Vocale aus Gent und ein Termin mit dem 80jährigen Musik-Minimalisten Terry Riley (29. August) nämlich stehen noch auf dem Augustprogramm. Unter der Leitung von Philippe Herreweghe bringen die Genter Johann Sebastian Bach zum Klingen. Am 16. August heißt das Programm „Ich elender Mensch“, am 21. August „Ich hatte viel Bekümmernis“.
Ab dem 12. September jedoch wird, wie wir doch hoffen wollen, Johan Simons’ „Rheingold“ der Jahrhunderthalle einheizen und neue Maßstäbe setzen. Angekündigt ist „eine ,Kreation’ an der Grenze zwischen Oper, Theater, Installation und Ritual“ (!). Die Musik machen das Orchester MusicAeterna aus Perm unter dem Dirigenten Teodor Currentzis und der finnische Techno-Experimentierer Mika Vainio. Sieben Termine sind angesetzt.
Weiter geht es nach Essen, in die auch ohne Theater schon beeindruckende Mischanlage der Kokerei Zollverein. Ein „Parcours“ ist sie, seit hier vor vielen Jahren die Ausstellung „Sonne, Mond und Sterne“ neue Maßstäbe in der kulturellen Umnutzung alter Industriebauten setzte. Nun erklingt hier, auf diesem Parcours, Monteverdis „Orfeo“, dezentral und verwirrend vorgetragen. Zur Musik werden Besuchergruppen von maximal acht Personen durch die Räume geführt, die nun die Stationen von Orfeos Abstieg zeigen nebst seinem Versuch, die Geliebte für sich zurückzugewinnen. Das Regisseurinnen-Trio Susanne Kennedy, Suzan Boogaerdt und Bianca van der Schoot, sagt die Ankündigung, habe in dem alten Betonbunker Qualitäten einer Vorhölle erkannt, und das kann man nachvollziehen. Eurydike übrigens, die spätere Salzsäule, wird von mehreren Schauspielerinnen gespielt.
Etliche weitere Tanz- und Musikproduktionen sowie Rauminstallationen können in diesem Text keine Erwähnung finden, weil es sonst einfach zu viel wird. Von den Schauspielproduktionen sei noch „Die Franzosen“ erwähnt, ein Werk des polnischen Regisseurs Krzysztof Warlikowski, in dem er Prousts „Suche nach der verlorenen Zeit“ mit weiteren Stoffen des Romanciers zum großen Sittenbild einer „Gesellschaft im Umbruch zwischen 19. und 20. Jahrhundert“ verwebt. Sein Nowy Teatr spielt das alles in polnischer Sprache und will sechsmal die Halle Zweckel füllen. Das wirkt ein bißchen optimistisch, aber man soll ja nicht unken.
Ach ja: Von Anne Teresa De Keersmaeker wird Ende September dreimal die Uraufführung ihrer Choreographie „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“ gezeigt, die Rilkes Erzählung über den begeisterten Türkenkrieg-Soldaten aktuell deutet; Regisseur Luk Perceval verarbeitet mehrere Stoffe Émile Zolas mit Darstellern des Hamburger Thalia-Theaters zu einem Gesellschaftsbild, das den Titel „Liebe – Trilogie meiner Familie I“ trägt. Die Teile II und III gibt es auf dieser Triennale noch nicht zu sehen.
So, das soll mal reichen. Glück auf!
www.ruhrtriennale.de