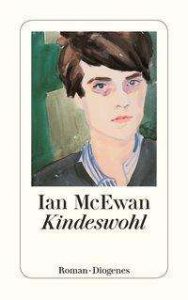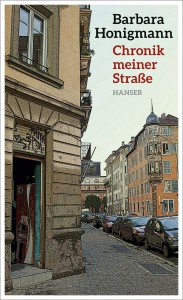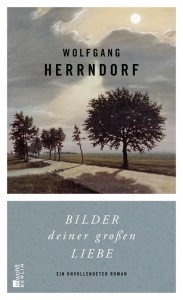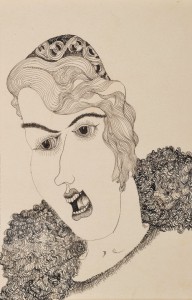Gestern war ich im Schauspiel Dortmund. Es war eine Einladung. Ich sollte mein Handy mitbringen, um damit während der Vorstellung zu fotografieren, zu filmen und Kurz-Texte darauf schreiben, so viele wie ich will. Dafür gab es freies W-Lan, ein Bier und eine Brezel. Es war mein erstes TweetUp, und es war – tja. Es war so, dass ich am Ende das Bedürfnis verspürte, mehr als 140 Zeichen zu schreiben. Also bitte, hier der Erfahrungsbericht.
Gestern war ich im Schauspiel Dortmund. Es war eine Einladung. Ich sollte mein Handy mitbringen, um damit während der Vorstellung zu fotografieren, zu filmen und Kurz-Texte darauf schreiben, so viele wie ich will. Dafür gab es freies W-Lan, ein Bier und eine Brezel. Es war mein erstes TweetUp, und es war – tja. Es war so, dass ich am Ende das Bedürfnis verspürte, mehr als 140 Zeichen zu schreiben. Also bitte, hier der Erfahrungsbericht.
Ein TweetUp ist eine Zusammenkunft von Twitterern, also Nutzern des gleichnamigen Microblogging-Dienstes, die während einer Veranstaltung über diese Veranstaltung kommunizieren – miteinander und mit dem Teil der Öffentlichkeit, der ihnen folgt. Damit man sich im Strom der ständig tickernden Tweets auch findet, wird vorab ein Hashtag bestimmt, den alle Twitterer in ihre 140-Zeichen-Kurznachrichten mit aufnehmen.
Der Hashtag hat das Zeichen einer Raute, #, er ist eine Art Code- und Schlagwort. An diesem Abend hieß der Hashtag #ZeitalterDo, denn das zu betwitternde Theaterstück hieß „The Return of Das goldene Zeitalter – 100 Wege, dem Schicksal das Sorgerecht zu entziehen“. Es war die Wiederaufnahme aus der vergangenen Saison, ein Stück über die unerträgliche Leichtigkeit der Routine und Rituale, die unser Leben beherrschen.
Hundert Male gehen in dem Stück uniformiert gekleidete Menschen Treppen rauf und runter, durchgetaktet und doch variantenreich. Die Figuren – darunter Heine, Goethe, eine „Erklär-Bär“, diverse Nachrichten-Sprecher sowie Adam und Eva – agieren auf spontanen Zuruf der Regie. Jeder Abend verläuft etwas anders – und doch wurde jeder Gedanke in diesem Stück schon einmal gedacht, jeder Satz schon einmal gesprochen, so oder anders.
Sie ist verstörend beruhigend, diese Wiederkehr des Immergleichen, die Routinen und Rituale sind absolut verrückt und doch vertraut und gut. Wir haben uns in ihnen eingerichtet, und auch ein vermeintlich exzentrischer Ausbruch aus dem Alltag ist wenig originell, sondern eine vor-gedachte, vorgelebte Sollbruchstelle.
Kay Voges’ und Alexander Kerlins „Goldenes Zeitalter“ ist eine verstörend wahre, absolut unterhaltsame, nachdenklich machende, musikalisch und filmisch genial umgesetzte Allegorie auf das Leben. Mehr zum Stück bitte nachlesen in der Besprechung der Premiere von Anke Demirsoy oder Rolf Pfeiffers aktuelle Besprechung – die Wiederaufnahme hat zwar einen anderen Untertitel und einige neue Szenen und Figuren, ist aber in Regiekonzept und Aussage deckungsgleich.
Ebenso neugierig wie auf das Stück, das ich noch nicht kannte, war ich auf das TweetUp: Wie würde ich mit der Möglichkeit umgehen, nonstop am Smartphone fummeln zu können? Was würde ich twittern, wieviel – und wie würde das die Konzentration und die Rezeption beeinflussen?
Zunächst bekamen wir Twitterer eine Einführung samt Vorstellungsrunde. Einer nach dem anderen nennt seinen richtigen und seinen Twitter-Namen und dazu einen persönlichen Hashtag, der das Befinden oder den eigenen Kontext angibt. „#Durst“, sagt einer, „#Ichfreuemichdassichdabeibin“. Die Kolleginnen und Kollegen fotografieren sich gegenseitig, fotografieren die Brezeln, den einführenden Dramaturgen und laden sie auf Twitter hoch. Soll ich auch schon? Ich fotografiere meine Eintrittskarte und schreibe dazu, dass man heute im Zuschauerraum trinken und fotografieren darf. Hm. Das haben die anderen auch schon getwittert.
Die meisten meiner Twitter-Kollegen stammen eher aus der Social-Media- denn aus der Kulturszene, und so hat man die Begleitmaterialien mit etwas mehr Infos versehen als für Theaterkritiker üblich: Die Twitterer erfahren zum Beispiel, dass das Schauspiel nur eine Sparte des Theaters ist und dass es auch noch Oper, Ballett, Philharmoniker und Kindert- und Jugendheater gibt.
Außerdem sagt die Mitarbeiterin aus der Öffentlichkeitsarbeit, dass es eine Burka-Szene geben wird und dass wir diese Bilder bitte nicht twittern sollen. Man wolle mit der Szene niemanden verletzen, und es könne ein falsches Licht auf die Inszenierung werfen, wenn diese Szene zusammenhanglos auf Twitter erscheine. Ich horche auf: Das ist neu. Von so einer Bitte habe ich noch nie gehört. Ich denke an den Kabarettisten Martin Kaysh, der 2013 mit Burkini ins Schwimmbad ging und daraus eine Nummer machte – aber das war vor Paris. Was ist von der Bitte zu halten? Wieso nimmt man die Szene ins Programm, hat aber gleichzeitig Angst, dass sie zu öffentlich wird? Die Gedanken dazu auf 140 Zeichen zu bringen – unmöglich. Ich twittere: Ok. Es wird eine Burka-Szene geben, aber mit der will man niemanden verletzen. Spannung steigt… #zeitalterdo“.
Es ist nicht das erste TweetUp des Dortmunder Schauspiels, man sammelt schon seit etwa einem Jahr Erfahrungen mit dem Format. Regelmäßig werden Twitterer und Blogger eingeladen, von Proben oder Veranstaltungen zu berichten. Es gab sogar interaktive Inszenierungen, in die die Tweets der Zuschauer eingebunden wurden; in denen sich Zuschauer und Schauspieler auf digitalem Wege beeinflussten. Das ist an diesem Abend nicht so – von den Aktivitäten der Twitterer nehmen vor allem die Twitterer selbst Notiz und Teile des Publikums, die schon vorab durch Aushänge informiert wurden: Wundern Sie sich nicht, dass da eine ganze Zuschauerreihe am Handy spielt – die sollen das.
Dann geht es los. Ich habe mir vorgenommen, mein Handy wie einen Schreibblock zu benutzen. Gewohnt, während der Vorstellung ständig etwas später meist Unlesbares und Halbgares auf Papier zu notieren, will ich nun eben zum Handy greifen. Doch das funktioniert nicht. Meine Beobachtungen, Beschreibungen, Wertungen würden auf Twitter keinen Sinn ergeben, außerdem zögere ich, etwas zu veröffentlichen, das ich am Ende des dreistündigen Abends vielleicht ganz anders sehen werde. Ich schreibe etwas über das wiederkehrende Geräusch der Klospülung und erhalte sogar mehrere Retweets und „Favs„. Aber was soll irgendjemand damit anfangen, der nicht im Stück war?
 Die Idee, der auf Twitter folgenden Öffentlichkeit von dem Stück in einer Sinn ergebenden Reihenfolge zu erzählen, gebe ich also schnell auf. Das entspräche schließlich auch nicht den Nutzungsgewohnheiten auf Twitter, wo sekündlich neue Tweets die alten verdrängen. Niemand wird meinen Botschaften in der von mir gedachten Reihenfolge folgen.
Die Idee, der auf Twitter folgenden Öffentlichkeit von dem Stück in einer Sinn ergebenden Reihenfolge zu erzählen, gebe ich also schnell auf. Das entspräche schließlich auch nicht den Nutzungsgewohnheiten auf Twitter, wo sekündlich neue Tweets die alten verdrängen. Niemand wird meinen Botschaften in der von mir gedachten Reihenfolge folgen.
Es bleibt nur, auf griffige – und kurze! Zitate und Gedanken zu warten. Auf Witziges, Überraschendes, Aktuelles. Schlagzeilen schreiben, den Nachrichtenfaktoren folgen.
 Dass die Schauspieler ihre Szenen in Dauerschleife wieder und wieder bringen, kommt mir entgegen: Wenn mir nach dem zweiten Durchgang auffällt, dass diese zwei Sätze ein schönes Video ergäben, halte ich beim nächsten Durchgang einfach drauf.
Dass die Schauspieler ihre Szenen in Dauerschleife wieder und wieder bringen, kommt mir entgegen: Wenn mir nach dem zweiten Durchgang auffällt, dass diese zwei Sätze ein schönes Video ergäben, halte ich beim nächsten Durchgang einfach drauf.
Die Qualität der Bilder aus dem dunklen Zuschauerraum ist erstaunlich gut, was an den großformatigen Bildern auf der Leinwand über der Bühne liegt. Wenig überraschend, dass ich dabei vor allem auf die spektakulären Bilder anspringe: Adam und Eva im Nackedei-Kostüm, der lustige Erklär-Bär, ein groß auf die Leinwand projiziertes vermeintliches Brecht-Zitat, mit dem das Schauspiel die aktuelle Diskussion um die Aufführung von Brechts Stücken kommentiert: „Der Urheber ist belanglos“.
Dann kommt die Burka-Szene, die wirklich gut ist: Drei Verschleierte stehen vorne auf der Bühne, dahinter riesengroß auf der Leinwand zwei wasserstoffblonde, gleich geschminkte und gekleidete Schauspieler, die da singen: „Ich bin anders als, du bist anders als, er ist anders als sie.“ Ich mache ein Video und lade es hoch. Es ist mein elfter Tweet aus der Vorstellung, vier weitere werden folgen, und ich finde nicht, dass da irgendetwas aus dem Zusammenhang gerissen ist – zumindest nicht mehr, als bei Twitter irgendwie immer alles aus dem Zusammenhang gerissen ist. Für den Kontext sorgt eigentlich nur der Hashtag.
Irgendwann, ich habe mich gerade in meinen Twitter-Rhythmus eingefunden, beginne ich damit, zu beobachten, was die anderen so twittern, verbreite ihre Tweets weiter, antworte und kommentiere. Phasenweise schaue ich minutenlang nicht auf die Bühne, dann wieder lange Zeit nicht aufs Handy. Das geht bei diesem Stück gut – es wird ja sowieso alles wiederholt.
Am Ende habe ich mich keine Sekunde gelangweilt und habe, anders als viele andere Zuschauer, meinen Platz nicht zum Bierholen verlassen. Wie wäre das ohne die Ablenkung durchs Twittern gewesen? Ich weiß es nicht. Und wie wäre es, über ein Stück zu twittern, das eine Geschichte erzählt, das sich entwickelt, das Beobachtung und Aufmerksamkeit erfordert? Ich kann und will es mir nicht vorstellen – genauso wenig kann ich mir vorstellen, mir parallel zum Twittern auch noch Notizen für eine ausführliche Kritik zu machen.
Twitter ist ein eigenes Medium, das einer eigenen Logik folgt. Als Medium der Theaterkritik ist es höchstens ergänzend geeignet, es bereichert die reflektierte Auseinandersetzung um spontane Eindrücke. In Zukunft, wenn Twitter in Deutschland populärer geworden ist, könnte es auch den gepflegten Zuschaueraustausch nach der Vorstellung ins Digitale verlagern bzw. erweitern – viele Menschen möchten nach einem Theaterabend gerne wissen, wie es anderen gefallen hat, haben aber Scheu, sich selbst in solche Diskussionen zu begeben.
Als Medium der Kritik ist der Theatertwitter aber, zumindest von Seiten des Theaters, erstmal gar nicht gedacht. Es ist ein Instrument der Öffentlichkeitsarbeit und soll vor allem die Botschaft transportieren, dass – ja, dass am Theater getwittert wird. Was, das spielt gar keine große Rolle.
Und genau das ist auch okay. Es ist gut. Es hat tatsächlich Menschen ins Theater gebracht, die dort vorher selten waren, und es erweitert die Öffentlichkeit für das Schauspiel. Und mir hat es Spaß gemacht.
Übrigens, wenn Sie mir auf Twitter folgen wollen, bitte hier entlang.