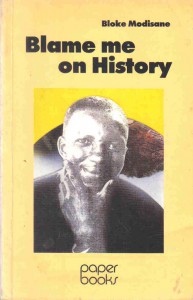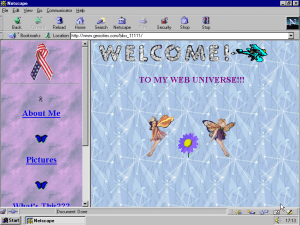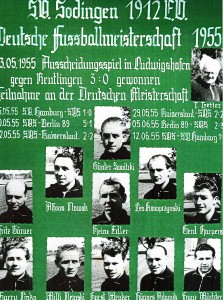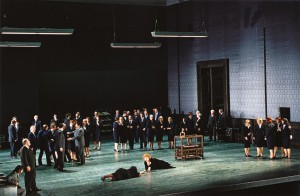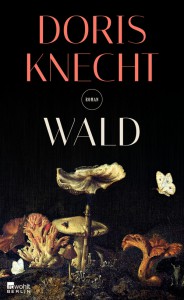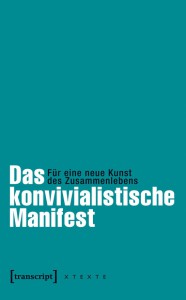An der Schwelle der Moderne: Vor 125 Jahren starb Vincent van Gogh an einem Schuss

Vincent van Gogh: Ein Selbstporträt mit grauem Filzhut von 1887. Das Bild gehört dem van Gogh Museum Amsterdam. Bis 6. September ist es in der Ausstellung „Van Gogh + Munch“ im Munch Museum Oslo zu sehen. Foto: Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
Seine Sonnenblumen, sein Selbstbildnis, seine Sternennacht: Bilder, die ins kollektive Gedächtnis eingegangen sind. Millionenfach reproduziert, weltbekannt. Vincent van Gogh, der niederländische Pfarrerssohn und exzentrische Außenseiter, gehört heute zu den populärsten Meistern am Beginn der Moderne – und zu den teuersten Malern im internationalen Kunstmarkt.
1987 wurden knapp 40 Millionen Dollar für eines seiner Sonnenblumenbilder gezahlt; drei Jahre später legte ein japanischer Sammler für das „Porträt des Dr. Gachet“ über 82 Millionen Dollar hin. Erst vor drei Wochen wurde bei Christie’s das frühe Aquarell der „Laakmolen“ bei Den Haag von 1882 für 2 Millionen Pfund versteigert.
Van Gogh war nicht zum Maler geboren. Erst mit 27 Jahren, im Herbst 1880, entschied er sich, Stift und Pinsel zu den Werkzeugen zu machen, mit denen er künftig seinen Lebensunterhalt verdienen – und mehr noch, sich selbst ausdrücken wollte. Die nötigen Kenntnisse eignete er sich selbst an. Er kopierte Zeichnungen und Drucke, um zu lernen, genoss gelegentliche Unterweisungen, etwa von seinem Cousin Anton Mauve. Sein Bruder Theo van Gogh kam für seinen Lebensunterhalt auf und erhielt dafür einen großen Teil von Vincents Werken.
Von der Theologie zur Kunst
Die nur 37 Jahre seines Lebens begannen mit einer Kindheit in Brabant, die van Goghs Liebe zur Natur weckten; mit einer schwierigen, mit 15 Jahren beendeten Schulzeit des eigenbrötlerischen Jungen; mit unglücklicher junger Liebe und der Suche nach einem Beruf.
Die Lehre bei einem bedeutenden Kunsthandel ging schief, weil van Gogh als Verkäufer ungeeignet war. In London fühlte er sich einsam, in Paris kapselte er sich ab und beschloss, ein Studium zu beginnen. An seinen Bruder Theo schreibt er: „Ich wäre unglücklich, wenn ich nicht das Evangelium predigen könnte … wenn ich nicht meine ganze Hoffnung und all mein Vertrauen auf Christus gesetzt hätte …“. Doch fand er die Theologie an der Universität einen „unbeschreiblichen Schwindel“, gab das Studieren auf und besuchte ein Laienprediger-Seminar in Brüssel.

Ging für zwei Millionen Pfund bei Christie’s weg: Vincent van Goghs „Laakmolen bei Den Haag“, ein Aquarell aus dem Jahr 1882. Foto: Christie’s
Eingesetzt als Hilfsprediger im Steinkohlerevier bei Mons in Belgien, identifiziert er sich bis hin zu einer bettelarmen Lebensweise stark mit den Arbeitern. Er malt die einfachen Menschen; er verschenkt Lohn, Lebensmittel, Kleider. Wohl auch, weil er radikal an die Ränder der Gesellschaft ging, wurde seine Anstellung nicht verlängert. Die Zurückweisung ist einer der Gründe, warum sich van Gogh vom Christentum abwandte, zeitlebens aber ein religiös und sozial sensibler Mensch geblieben ist.
In Brüssel, unterstützt von Bruder und Eltern, versucht er, sich zum Maler heranzubilden, besucht Museen, beginnt zu zeichnen. Entscheidend für van Goghs künstlerische Entwicklung ist die Begegnung mit der Kunst des Impressionismus im Paris der Jahre 1886 bis 1888. Van Gogh lebt dort bei seinem Bruder Theo und lernt später berühmt gewordene Maler kennen, von Alfred Sisley über Henri Toulouse-Lautrec bis Paul Gauguin.
Der Einfluss japanischer Farbholzschnitte beeinflusst seine Malweise: Er verzichtet auf Körper- und Schlagschatten und trägt die Farben, wie er selbst schreibt, „flach und einfach“ auf. Die japanische Kunst empfindet er aufregend neu: „Ist, was uns die Japaner zeigen, nicht einfach eine wahre Revolution…?“, schreibt er. Die Bilder von Eugène Delacroix bestärken ihn, seine Farbwahl zu ändern: Er verwendet nun kräftige und helle Farben, die sich gegenseitig verstärken.
Diese Einflüsse und sein gereifter persönlicher Stil führten zu der typischen Malweise, die wir heute mit van Gogh verbinden. Im Februar 1888 flieht der Maler aus Paris nach Arles: Psychisch angeschlagen, genervt von den Streitereien der Malerkollegen, strapaziert von der hektischen Großstadt und zermürbt von Absinth-Exzessen versucht er in Südfrankreich, zu sich selbst zu finden. In Arles will er in der Natur reine, intensive Farben finden, wie sie ihn interessieren: die „schönen Gegensätze von Rot und Grün, von Blau und Orange, von Schwefelgelb und Lila“.
Intensive Farben, symbolische Gegenstände
Van Gogh wählt für seine Bilder nicht mehr die natürlichen Farben der Gegenstände oder der Landschaft. Er entwickelt stattdessen für jedes Bild ein Farbschema, mit dem er eine „gute Wirkung“ erzielen will. Die Farben stehen – wie auch Gegenstände im Bild – für eine symbolische Aussage: „Ich habe versucht, mit Rot und Grün die schrecklichen menschlichen Leidenschaften auszudrücken“, schreibt er etwa zu seinem Bild „Das Nachtcafé“ von 1888. Auch seine Malweise ändert sich: Der dicke Farbauftrag macht die Pinselstriche sichtbar, neben die glatt aufgetragenen treten gestrichelte Farben, die van Gogh in Wellen oder rhythmischer Bewegung anordnet. Dass er seine Bilder schnell und ohne zu überlegen gemalt hat, ist eine Legende. Vielen Motiven gingen intensive Studien voraus.

Das van Gogh Museum Amsterdam. Es zeigt ab 25. September die Ausstellung „Munch – van Gogh“. Foto: Rene Gerritsen/van Gogh Museum Amsterdam
Eine der van-Gogh-Legenden ist auch, dass ihn plötzliche Wahnsinn befallen und er sich sogar ein Ohr abgeschnitten habe. Vermutlich hat er sich lediglich im Rausch am Ohr verletzt. Dass van Gogh psychisch angeschlagen war, hat er selbst in den letzten Lebensjahren als zunehmend belastend erlebt.
Im Mai 1889 ließ er sich in der Nervenheilanstalt Saint-Rémy-de-Provence unterbringen, im Mai 1890 zog er nach Auvers, wo er Patient des heute sehr kritisch betrachteten Arztes Dr. Gachet wurde. Dort entstanden in einem Schaffensrausch rund 140 Werke.
Vor 125 Jahren, am 27. Juli 1890, schoss sich Vincent van Gogh wohl selbst eine Kugel in den Körper. Neue Biographen bezweifeln jedoch die Selbstmord-These. Sie ziehen einen Unfall oder sogar eine Tötung durch einen anderen in Betracht. Zwei Tage später starb er an der Verletzung. Entgegen landläufiger Meinung war van Gogh zum Zeitpunkt seines Todes ein im Kreis seiner Kollegen höchst anerkannter Maler.
Das van Gogh Museum Amsterdam würdigt seinen Namensgeber im 125. Todesjahr mit zahlreichen Veranstaltungen. Ab 25. September ist dort die Ausstellung „Munch – van Gogh“ zu sehen, die Ähnlichkeiten zwischen beiden Malern und den Einfluss van Goghs auf die Entwicklung von Edvard Munch thematisiert. Info: http://vangogheurope.eu/event/munch-vangogh/