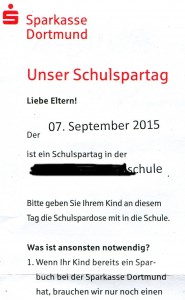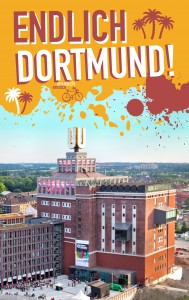Die Illusionen sind dahin – „Raketenmänner“ von Frank Goosen in Oberhausen

„Raketenmänner“ in Oberhausen, Szene mit Torsten Bauer und Anja Schweitzer (Foto: Klaus Fröhlich/Theater Oberhausen)
Wie soll man sie nennen? Mitmenschen, Nachbarn, Allerweltsgestalten, Normalos? Das Personal wirkt ziemlich durchschnittlich.
Eine Frau, die weiß, dass ihr Mann fremdgeht, ein Mann, der gerne fremdgehen würde, ein unglücklicher Angestellter, den der Vorgesetzte mobbt, ein alternder Platzwart, zwei alte Freunde, die sich nicht mehr richtig verstehen, eine Demente, ein sterbender Kinobesitzer – sie bevölkern das erste Theaterstück des Bochumer Autors und Kabarettisten Frank Goosen, das in Oberhausen Premiere hatte und, auf den ersten Blick etwas unverständlich, „Raketenmänner“ heißt.
Eine alte Schallplatte
Doch ist der Titel flugs auch im Stück erklärt: „Raketenmänner“ lautet der Titel einer fiktiven Langspielplatte, die ein gleichfalls fiktiver Stefan Moses in den 70er Jahren aufnahm. Dieses Album geistert nun durch die sich reihenden Szenen, ist für den jungen Wenzel (Thieß Brammer), der mutig einen Laden mit Vinyl-Schallplatten übernommen hat, eine unerwartete Begegnung mit familiärer Vergangenheit, ist für die meisten anderen eine verklärende Erinnerung, Sinnbild für Träume und Sehnsüchte. „Bass, Gitarre, Schlagzeug, manchmal ein Klavier. nichts Besonderes“, erinnert sich Gaby (Anja Schweitzer) im Verlauf des Stücks, „ich kann das irgendwie nicht richtig erklären“. Es war wie eine Verheißung, gleichwohl: Die Raketen zündeten nicht, sie alle blieben auf der Erde mit ihren tiefgrauen Problemen.
Stellenweise lustig
Eine gewisse Nähe zum Kabarett ist in der Inszenierung des Oberhausener Intendanten Peter Carp unübersehbar, und würde Frank Goosen selber vortragen, kämen einige Episoden wohl noch kerniger über die Rampe.
Doch muss einem Missverständnis vorgebeugt werden: Trotz des Personals, das einem aus Goosens Themenkosmos bekannt vorkommt, trotz einer zumindest vorstellbaren Verortung im Ruhrgebiet und trotz Dialogen, die kurz und klar sind und oft auf Pointen zielen, ist dieses Stück nicht wirklich lustig. Wenn schon nicht eine Lebensbilanz à la Becketts „Das letzte Band“, so ist es doch so etwas wie die illusionslose Ermittlung eines Zwischenstandes der „Generation Goosen“, die jetzt so um die 50 Jahre alt ist. Und wer in dem freien Journalisten Kamerke (Torsten Bauer), der wie zufällig durch die Episoden treibt und mit den Leuten redet, ein Alter Ego des Autors zu erblicken glaubt, liegt sicher nicht ganz falsch.

Im Plattengeschäft gibt es noch richtiges Vinyl, auch die Platte „Raketenmänner“. Szene mit Thieß Brammer und Torsten Bauer. (Foto: Klaus Fröhlich/Theater Oberhausen)
Sehnsucht nach den Sternen
Das Theaterstück ist die Fortschreibung eines gleichnamigen Romans und, wenn man so will, eine Variation auf die Geschichte „The Rocket Man“ des amerikanischen Science-fiction-Autors Ray Bradbury, der durch den später verfilmten Roman „Fahrenheit 451“ berühmt wurde. Sie erzählt 1951 bereits von einem Astronauten und seiner Sehnsucht nach den Sternen und der Unendlichkeit des Alls, während er noch daheim im trauten Kreis der Familie sitzt. Der Elton John-Hit „Rocket Man“ ist ebenfalls von dieser Geschichte inspiriert.
Eine verwahrloste Bühne
Nach der Pause, wenn die Zahl der Einzelepisoden abnimmt und die Gespräche länger werden, hat sich auch das Bühnenbild (Manuela Freigang) geändert. Die alte plüschige Guckkastenbühne, die in der ersten Hälfte nur einen schattigen Hintergrund bildete, dominiert nun die Szene, und deutlich erkennt man jetzt ihre völlige Verwahrlosung. Die Bühne des Lebens, plakativ ruiniert – ist die Bilanz denn wirklich gar so düster?

Junge Menschen, alte Platte: Laura Angelina Palacois, Eike Weinreich. (Foto: Klaus Fröhlich/Theater Oberhausen)
Nun, zumindest träumt hier keiner mehr, und in diesem Punkt unterscheidet sich Goosens Personal grundlegend beispielsweise vom dem Yasmina Rezas („Der Gott des Gemetzels“), die in ihren Stücken ja auch sehr sorgfältige Gesellschaftsbilder zeichnet, deren Personal jedoch immer wieder in Widerspruch zwischen eigenen (mitunter absurden) Idealvorstellungen und den Widrigkeiten der Welt gerät.
In den eigenen Stiefeln sterben
Doch wenn die Menschen keine Träume mehr haben, dann muss eben ein Wunder geschehen. Oder zumindest etwas Wunderbares. Deshalb darf der todkranke Kinobesitzer, dessen Liebe zu den guten alten Wildwestfilmen sich auf nachfolgende Generationen übertrug, in seinen Stiefeln sterben, wie es im Westen halt Brauch war. Und schließlich singen alle zum leisen, treibenden Trommelschlag „Do Not Forsake Me, Oh My Darlin“ aus Fred Zinnemanns Western-Klassiker „High Noon“ („Zwölf Uhr mittags“) mit Gary Cooper in der Hauptrolle. Will vielleicht auch sagen: Das haben wir zusammen erlebt, das kann uns keiner nehmen.
Ein gefühltes Viertelstündchen dauerte es, bis sich das Oberhausener Ensemble mit dem neuen Stück warmgespielt hatte, dann aber war sein Auftritt überzeugend. Dankbarer, anhaltender Applaus.
- Termine: 30.9., 2., 16., 17.,10.
- www.theater-oberhausen.de
- Karten-Tel. 0208 8578 184