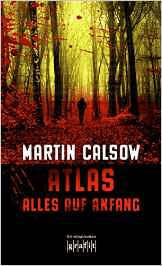Das letzte maritime Motto der Ruhrfestspiele lautete 2014 „Inselreiche: Land in Sicht – Entdeckungen“ und bot, wenn ich mich recht erinnere, vor allem gute Gelegenheiten, das eine oder andere Shakespeare-Stück auf die Festspielhausbühne zu stellen. Nun, nach dem französischen „Tête-à-tête“-Intermezzo 2015, ist wieder ein Meer das Thema, das Mittelmeer, das „Mare Nostrum“.
(Auch) wir im kalten Deutschland dürfen es „unser Meer“ nennen, weil (unsere) abendländische Kultur ebenso wie die monotheistische Religionen dort, im Mittelmeerraum, entstanden. Das soll nicht vergessen werden, auch nicht in Zeiten, in denen dieses Meer zum Symbol für massenhafte Flucht und für massenhaftes Sterben auf dieser Flucht geworden ist.
Burgtheater macht den Anfang
Wie bei den Ruhrfestspielen der Vergangenheit ist die Betitelung recht unverbindlich, und sicherlich hätte auch ein anderes Banner gehißt werden können, schaut man auf die Auswahl der Stücke. Die ersten Produktionen im Großen Haus verbindet mit dem Mittelmeer kaum mehr als der Ort des Entstehens beziehungsweise der Ort des Handelns.
Den Anfang macht die 1747 erschienene und überaus süffige Komödie „Der Diener zweier Herren“ von Carlo Goldoni, eine Koproduktion mit dem Wiener Burgtheater mit Peter Simonischek in der Titelrolle, Spielort ist Venedig.
Es folgt, als Regiearbeit des Hausherrn Frank Hoffmann, „Das Leben ein Traum. Caldéron“. Die Inszenierung des Luxemburger Nationaltheaters und des Schauspiels Hannover steht sozusagen auf zwei Füßen, verwendet die Originalvorlage Pedro Calderón de la Barcas ebenso wie Pier Paolo Pasolinis Filmadaption, die Calderóns bedrohlichen Königssohn durch eine Protagonistin ersetzt, in deren Schicksal der vermeintlichen Befreiung sich die gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen spiegelt. Das verspricht im beste Sinne interessant zu werden und ist zudem mit Dominique Horwitz, Jacqueline Macaulay, Hannelore Elsner, Wolfram Koch und anderen hervorragend besetzt.
Der experimentierfreudige Romeo Castellucci
Nach so viel Theaterwucht ist für Mitte des Monats, den 16. und 17. Mai, im großen Haus ein wenig tänzerische Leichtigkeit sicherlich hoch willkommen. Romeo und Julia, deren berühmter Balkon bekanntlich in Verona hängt, kommen aus Biarritz nach Recklinghausen und tanzen zur Musik von Hector Berlioz eine Choreographie von Thierry Malandain, denn man hier aus dem letzten Jahr noch in guter Erinnerung hat.
Doch dann naht Romeo Castellucci mit einer „Orestie“ – in der Bearbeitung von Romeo Castellucci und in der Regie von Romeo Castellucci. „Castelluccis Inszenierung arbeitet mit Bildern, die wie ein Schock wirken“, verkündet das Programmheft.
Bei der vorletzten Ruhrtriennale, noch unter der Ägide von Heiner Goebbels, der eine oder andere wird sich erinnern, gab es schon einmal eine Begegnung mit Romeo Castellucci. Da brachte er Igor Strawinskys Ballett „Le sacre du printemps“ ohne menschliche Mitwirkung mit einer Maschinerie zur Aufführung, die rhythmisch Knochenmehl von der Decke herabrieseln ließ. Das Knochenmehl stammte aus industrieller Produktion und von geschlachteten Tieren, sollte in dieser szenischen Installation aber auch Zusammenhänge insinuieren zwischen Tieropfer und Fleischverzehr und Schuld und was nicht sonst noch allem. Wenigstens war das Publikum durch eine Folie vor dem Bühnenstaub geschützt. Diesmal gibt es, wird verheißen, lebende Tiere auf der Bühne. Was ist davon zu halten, wenn im Programmheft „Empfohlen ab 16 Jahren“ steht?
Asylsuchende aus der Antike
Sodann betritt Elfriede Jelinek die Bühne – sinngemäß jedenfalls, persönlich gilt sie ja eher als scheu. „Die Schutzflehenden/Die Schutzbefohlenen“ von Aischylos stehen auf dem Programm, aus dem Griechischen übersetzt von Dietrich Ebener/Elfriede Jelinek. Die Töchter des Danaos sind, um Versklavung und Zwangsheirat zu entkommen, über das Mittelmeer geflohen; Argos gewährt Asyl, Ägypten droht. Der Plot wirkt aktuell, mal sehen, was das Schauspiel Leipzig daraus gemacht hat. Immerhin reisen sie mit „46 Leipzigerinnen und Leipzigern im Chor“ an. Regie führt Enrico Lübbe.
Houellebecq mit Edgar Selge
Von Namedropping halte ich generell nicht viel, aber hier reizt es einen schon: Michel Houellebecq, Karin Beier, Edgar Selge, Deutsches Schauspielhaus Hamburg. Bedeutet: Karin Beier hat Michel Houellebecqs immer noch aktuelles Buch „Unterwerfung“ in Hamburg zu einem Einpersonenstück mit Edgar Selge in der Hauptrolle verarbeitet. Der Plot, man erinnere sich, war der, daß bürgerliche und sozialistische Politiker nach erschütternden Wahlerfolgen des populistischen „Front national“, um diesen zu verhindern, Islamisten den Weg in die Regierung ebneten und Frankreich zu einem Land der Scharia machten. Durch den islamistischen Mordanschlag auf die Redaktion der Zeitschrift „Charlie Hebdo“ kurz nach Erscheinen von Houellebecqs Buch erhielt dieses eine gespenstische Aktualität. Nun also, wie auch immer, Edgar Selge. Ich bin sehr gespannt!
Es gibt einen „Nathan“ vom Deutschen Theater Berlin, bei dem Andreas Kriegenburg Regie führt und der, wie Intendant Frank Hoffmann versichert, durchaus auch humorvoll sein soll. „Rocco und seine Brüder“ ist eine Bühnenadaption des Visconti-Films durch das Schauspiel Hannover und paßt thematisch fraglos gut zum Thema Mittelmeer-Migration. Übrigens spielt Cosma Shiva Hagen mit.
Symposium zum 70. Geburtstag
„Don Giovanni. Letzte Party“, eine Produktion des Hamburger Thalia-Theaters, wird angekündigt als „ziemlich stückgetreue, ziemlich durchgeknallte Okkupation der Oper aller Opern“. Schauspieler spielen und singen, als Autoren werden Wolfgang Amadeus Mozart und Lorenzo da Ponte genannt, Antú Romero Nunes gar sei ein wahrer „Regiewunderknabe“. Alles klar? Jedenfalls verheißt die Ankündigung Kurzweil.
Mitte Juni, so ist es Brauch, neigt sich das Festival dem Ende zu. Das ist seit 70 Jahren so und somit Grund genug, ein Symposium darüber abzuhalten. Am 14. und 15. Juni also feiert man den Siebzigsten, und Klaus Peymann, der Unermüdliche, hält einen großen Vortrag.

Cosma Shiva Hagen spielt in „Rocco und seine Brüder“ mit. (Foto: Ruhrfestspiele)
Aus Berlin kommt die Volksbühne
Was haben wir noch? Zweimal Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, immerhin, einmal sogar mit einem Stück, bei dem deren Chef Frank Castorf Regie führt. Castorf, Ältere werden sich erinnern, war für ein Jahr selbst einmal Intendant der Ruhrfestspiele, Nachfolger von Hansgünther Heyme, und in diesem Jahr bescherte er dem Festival mit seinen – nennen wir sie: unorthodoxen – Ideen einen Einbruch beim Kartenverkauf um rund ein Viertel. Klar war, daß Castorf und Ruhrfestspiele nicht zueinander paßten, nach etwas Krisenmanagement übernahm Frank Hoffmann 2004 das Zepter, und er schwingt es erfolgreich bis heute.
Wenn Frank Castorf jetzt trotzdem mit „Die Kabale der Scheinheiligkeiten. Das Leben des Herrn Molière“ auf Recklinghausens grünem Hügel gastiert, so hat das Stil und wir verneigen uns. Das Stück – laut Programmheft nicht „von“, sondern „nach“ Michail Bulgakow, umfiebert eine Episode, die es angeblich wirklich gegeben hat: Nachdem Bulgakow Stalin, dem schrecklichen, allmächtigen, doch auch geliebten Stalin einen Brand- und Klagebrief geschrieben hatte mit der Bitte, ihn von Angst und Terror zu erlösen und aus der noch jungen Sowjetunion ausreisen zu lassen, rief dieser ihn persönlich an. Und danach nie wieder.
Der Künstler und sein Überleben
Doch wenigstens überlebte Bulgakow, Verfasser des weltberühmten Romans „Der Meister und Margarita“, schrieb, und die Beinahebegegnung mit Stalin verpflanzte er dramatisch an den Hof den Sonnenkönigs Ludwig XIV, wo ein Hofdichter Molière ganz ähnlich zu empfinden scheint wie weiland Bulgakow unter Stalin. Es geht, man sieht’s, um Künstler, Staat und Zensur und um das nackte Überleben. Und da Frank Castorf mit seinem 64 Jahren mittlerweile zu den „Altmeistern“ gezählt werden kann und da er sich viele Jahre lang sehr intensiv an Dostojewkij-Stoffen abgearbeitet hat und als Russenversteher gilt, möchte man nun wissen, was er ganz altmeisterlich aus der Geschichte macht. Premiere war übrigens letztes Jahr schon in Berlin.
Das zweite Berliner Volksbühnenstück ist eine „Apokalypse“ nach dem Johannesevangelium in der Regie von Herbert Fritsch. Grell und slapstickhaft, so Intendant Frank Hoffmann, soll es hier (auch) zugehen, es spielen Wolfram Koch und Ingo Günther, und am Ende ist klar, daß die Apokalypse ein treuer Begleiter und ein zeitloses Phänomen ist.
Zwei aktuelle Stücke zum Thema Migration
So, damit wäre das Programm im Großen Haus durchgearbeitet. Die weiteren Spielstätten Kleines Theater, Halle König Ludwig 1/2, Theater Marl und Theaterzelt in gleicher Intensität durchzuarbeiten, würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen, er ist ja jetzt schon viel zu lang. Deshalb nur einige mehr oder weniger subjektive Hinweise. Zwei Produktion beschäftigen sich ganz aktuell mit dem Thema Migration, „Zawaya. Zeugnisse der Revolution“ von der Compagnie El Warsha Kairo und „Am Rand“ von Sedef Ecer, das Hansgünther Heyme, der alte Kämpe, im Hamburg als Koproduktion mit den Ruhrfestspielen inszeniert hat, beide im Kleinen Theater.

Anklagebank? Symbolhaftes Bühnenbilddetail aus „Zawaya. Zeugnisse der Revolution“. (Foto: Tamer Eissa/Ruhrfestspiele)
In „Zawaya“ läßt Regisseur Hassan El Geretly fünf Personen sich an den „arabischen Frühling“ erinnern, an die ägyptische Revolution: einen Kleinkriminellen und Spitzel, einen Offizier, die Mutter eines toten Rebellen, einen arbeitslosen Fußballfan und eine Krankenschwester. Was ist die Wahrheit, was ist die Zukunft? Arbeitsprinzip der Compagnie El Warsha ist es laut Programmheft, zu den einfachen Menschen auf der Straße zu gehen, sie reden zu lassen und sie zu authentischen Chronisten des Geschehenen zu machen. Das Stück läuft in arabischer Sprache mit deutschen Untertiteln.
„Am Rand“, die Geschichte der türkischen Autorin Sedef Ecer, dreht sich um Menschen aus Afrika, die anderswo das Paradies suchen und im Vorstadtslum landen, eben am Rand. Paris ist nicht das Paradies (ein wohlfeiles Wortspiel), sondern die Banlieue. Und statt Paris könnte es Istanbul, Kairo oder Tripolis sein. Auch wenn man nur gedämpfte Erwartungen an den Inszenierungsstil Heymes hegt, scheint diese Produktion doch gut geeignet zu sein, das Publikum jenseits der üblichen Tagesthemen-Stanzen etwas klüger zu machen über das, was junge Menschen aus Afrika in die Migration treibt.

Der Chor ist in Aufruhr. Szene aus „Die Schutzflehenden/die Schutzbefohlenen“ von Aischylos, Dietrich Ebener und Elfriede Jelinek. (Foto: Bettina Stöß/Ruhrfestspiele)
Der Intendant versteckt sich
In der Halle König Ludwig 1/2 versteckt, so muß man fast sagen, Frank Hoffmann eine weitere eigene Regiearbeit. In Luxemburg brachte er Sergio Blancos Zweipersonendrama „Theben-Park“ heraus, die Reinszenierung eines Vatermords auf der Theaterbühne, ein Stück im Stück mithin. Wie erzählt man eine solche Geschichte, wie verändert sie sich, wenn man sie erzählt? Ödipus, Dostojewski und Siegmund Freud grüßen von der Empore, wir dürfen auf eine spannende psychologische Studie hoffen. Maik Solbach und Nicolai Despot spielen, und da Luxemburg nicht Deutschland ist, ist dies jetzt sogar eine deutsche Erstaufführung.
Winkelmanns neuer Film
Am 12. Mai läuft Adolf Winkelmanns neuer Film „Junges Licht“ in der Essener Lichtburg. Vorlage war Ralf Rothmanns Nachkriegskindheitsroman gleichen Titels, es spielen unter anderem Charly Hübner, Lina Beckmann, Peter Lohmeyer und Stephan Kampwirt. Und sicherlich wird er Film auch andernorts zu sehen sein.
Erstmalig gibt es Kooperationen mit dem Gelsenkirchener Ballett im Revier („Prosperos Insel“ nach Motiven von William Shakespeare) und dem Dortmunder Theater („Die Simulanten“ von Philippe Heule) und auch Rimini Protokoll fehlen nicht. In ihrer Aktion „Truck Tracks Ruhr # 2 Album Recklinghausen“ bitten sie das geneigte Publikum auf die Ladefläche eines Lastkraftwagens, wo es – sichtgeschützt – zu markanten und fest versprochen so noch nie wahrgenommenen Besichtigungspunkten des Reviers gefahren wird, die man dann klangvoll präsentiert. Klingt gut, schaun mer mal.
Bemerkenswert ist, was diesmal fehlt: Es fehlt der glamouröse Gast (jeglichen Geschlechts) aus dem Filmgeschäft, in einer glamourösen Produktion. Keine Ute Lemper, keine Heike Makatsch und erst recht kein Philip Seymour Hoffman seligen Angedenkens. Werden wir die internationalen Stars vermissen? Einst standen sie für die Weltläufigkeit der Ruhrfestspiele, doch seit Jahren schon wirkten sie etwas verloren in einem Programm, das doch ganz unübersehbar seinen Schwerpunkt beim deutschsprachigen Theater setzt. Schlimm wäre es, wen aktuelle Themen und Diskussionen nicht mehr Eingang in das Programm fänden. Doch diesen Vorwurf kann man den Ruhrfestspielen 2016 nicht machen.
Glück auf!
Weitere Informationen: www.ruhrfestspiele.de