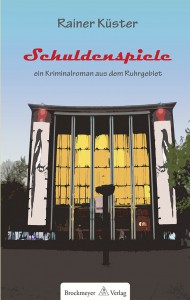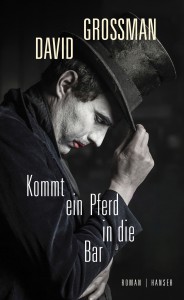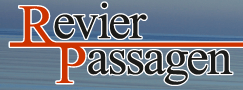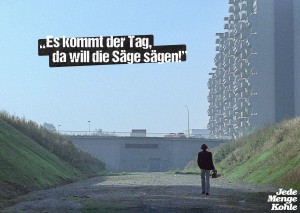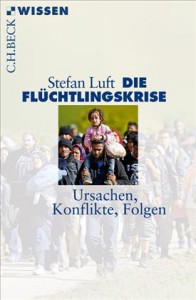In dem Zeitraum zwischen 1941 und 1956, den der zweite Band der Briefausgabe umfasst, schrieb Samuel Beckett seine bekanntesten Romane und Theaterstücke. In schneller Folge erschien die Romantrilogie mit Molloy (1951), Malone stirbt (1951) und Der Namenlose (1953), und dazwischen, 1952, die Druckfassung von Warten auf Godot – das Stück, das ihn schon bald nach seiner Uraufführung im Januar 1953 berühmt machen sollte.
Jedoch kamen solche Erfolge keinesfalls aus dem Nichts; und auch, was als Erfolg anzusehen ist und was nicht, stellt sich in seinen Briefen – nicht anders als in Becketts gesamtem literarischen Werk – als etwas Relatives dar.

Die Geldsorgen seiner jungen Jahre haben nun neuen Nöten Platz gemacht. Auskunftsbegehren von Literaturwissenschaftlern, Übersetzern, Verlegern und Verehrern lassen die Korrespondenz mit Jugendfreunden, die den ersten Band der Beckett-Briefe prägten, in den Hintergrund treten. Kein ausgedehntes Umherschweifen von Museum zu Museum wie in der Vorkriegszeit; stattdessen nur wenige notwendige Reisen, meistens nach Irland.
Es ist auch der Zeitraum, in dem die beiden engsten ihm verbliebenen Angehörigen sterben, seine Mutter (1950) und sein Bruder Frank (1954). Vor allem aber liegt zwischen den Briefen aus Band 1 und denen des zweiten Bandes der Krieg, der ihn einiger seiner Freunde und Mitstreiter aus der Résistance beraubte – wie Alfred Péron, der ihm bei der Übersetzung seines ersten Romans Murphy (1938) ins Französische geholfen hatte.
Alfred Pérons Frau Maria, genannt Mania, konnte den Autor und seine Lebensgefährtin Suzanne Deschevaux-Dumesnil noch rechtzeitig mit einem Telegramm vor der Verhaftung durch die Nazis warnen. Die beiden versteckten sich daraufhin in Rousillon, einem abgelegenen Ort in der Vaucluse. Um 1943 füllte Beckett dort mehrere Notizbücher mit seinem letzten in englischer Sprache entstehenden Roman, Watt, der erst zehn Jahre später veröffentlicht wurde. Im Januar 1945 sandte Beckett ein Lebenszeichen an seinen Bruder Frank in Irland; die umfangreiche Korrespondenz sollte jedoch erst nach Kriegsende wieder einsetzen.

Das Haus in Rousillon (Vaucluse), in dem Beckett und Suzanne Deschevaux-Dumesnil von Oktober 1942 bis Oktober 1944 wohnten; Foto: Wolfgang Cziesla, März 2015
Nicht von sich selbst absehen können
Einen Höhepunkt der Briefkunst dieser Jahre stellt die Korrespondenz mit dem Kunsthistoriker Georges Duthuit dar. Hier bilden sich die Formulierungen heraus, die 1949 als „Drei Dialoge“ (über Tal Coat, André Masson und Bram van Velde) in der von Duthuit mitherausgegebenen englischsprachigen Zeitschrift Transition veröffentlicht wurden und 1967 erstmals auf Deutsch in einem Auswahlband erschienen sind.
Zugleich wird ablesbar, wie Beckett in der Auseinandersetzung mit den Künstlerfreunden sich selbst auf die Spur kommen möchte. „Nur weil ich davon besessen bin, mich in eine Situation zu begeben, die buchstäblich unmöglich ist und die Du das Absolute nennst, hefte ich ihn [Bram van Velde] mir an meine Seite.“ Dabei äußert er auch Skrupel, dem Maler nicht gerecht geworden sein.
Die Frage nach Erlebtem und Fiktion in seinem Werk beantwortet Beckett in einem Brief an Georges Duthuit vom März 1949: „Aber bedenke, dass ich, der ich fast nie über mich spreche, fast nie über etwas anderes spreche.“ Jemand wie Beckett tut sich schwer mit Erwartungen, die an ihn herangetragen werden – auch dann, wenn er sich selbst zu etwas verpflichtet fühlt. Die Verehrung für den Maler Jack B. Yeats (den Bruder des Dichters William Butler Yeats) ging bereits in Becketts bitterarmen Jugendjahren so weit, dass er lieber mit verschlissenen, regenuntauglichen Schuhen herumlief, als auf das kleine Gemälde, das Yeats ihm zu einem Freundschaftspreis zu überlassen bereit war, zu verzichten.
Nach seinen ersten größeren Erfolgen vermittelte Beckett dem älteren Freund eine Ausstellung in Paris und kümmerte sich um positive Besprechungen. Über seinen eigenen Beitrag zu einer Würdigung in der Literaturzeitschrift Les Lettres Nouvelles äußert er sich in einem Brief: „Zu Yeats brachte ich nach Stunden und Tagen buchstäblicher Folterqualen eine kurze Seite der jämmerlichsten Art zustande, die, irritiert und müde, das genaue Gegenteil dessen ist, was ich so gern gewollt hätte. Selbst für diesen großen alten Mann, den ich liebe und verehre, war ich nicht imstande, ein wenig von mir abzusehen.“ (Samuel Beckett an Georges Duthuit am 2. März 1954)
Sein expressives Bedürfnis ist gleichzeitig von dem Bewusstsein beherrscht, dass die Mittel des Expressiven bereits ausgeschöpft sind. Er fühlt sich kraftlos und müde. Was Beckett im Januar 1949 an Bram van Velde schrieb – er „suche nach einem Weg, zu kapitulieren, ohne ganz und gar zu verstummen“ – könnte auch als Motto über seinem Gesamtwerk stehen.
Das Erzählen an einen Endpunkt geführt
In Becketts Romanen lässt sich von Murphy über Watt und dann vor allem in der Trilogie Molloy – Malone stirbt – Der Namenlose eine Entwicklung zum Immer-weniger nachvollziehen. Über den letzten Teil der Trilogie schreibt er im Februar 1952: „Das dritte, L’Innommable, kommt wahrscheinlich im Frühjahr und ist wohl das Ende der Partie, soweit es mich betrifft, da niemand mehr da ist, der spricht und, unabhängig davon vielleicht und ohnehin überflüssigerweise, nichts, wovon zu sprechen wäre.“
Durch immer radikalere Reduktion hat sich Beckett Schritt für Schritt in die Ausweglosigkeit geschrieben. Seine Protagonisten geben nach und nach alles auf: ihren Besitz, ihren Körper, bis in Der Namenlose nur noch die Sprache selbst übrigbleibt, ohne einen Sprechenden. „Was liegt daran wer spricht, jemand hat gesagt, was liegt daran wer spricht“, heißt es im dritten der Texte um Nichts (Nouvelles et Textes pour rien; 1955 veröffentlicht) – ein Satz, den nicht zuletzt Michel Foucault in seinem kanonischen Text Was ist ein Autor? aufgegriffen hat.
„Absurder- und blöderweise bin ich die Kreatur meiner Bücher, und L’Innommable ist schuldiger an meiner gegenwärtigen Misere als alle anderen guten Gründe zusammengenommen“, teilt er am 27. Dezember 1954 seiner Freundin Pamela Mitchell mit. Und an Jacoba, die jüngere Schwester von Bram van Velde, schreibt er: „Nach L’Innommable habe ich nichts mehr zustande gebracht, das ist das Ende der Fahnenstange. Wenn Du es liest, verstehst Du vielleicht, warum. Ich zucke noch, aber ohne Resultat. Es wäre besser, ich könnte mich zum Aufgeben entschließen. Vielleicht komme ich noch dahin.“
Mit dem „Zucken“ sind die kurzen Texte um Nichts gemeint, Schritte auf dem langen Weg kunstvollen Verstummens. „Und ich habe in letzter Zeit etwa zehn kleine Texte geschrieben. Nachgeburten des L’Innommable und auf direktem Wege unzugänglich.“ Drastischer noch drückt er sich im April 1951 gegenüber Mania Péron aus: „In Paris muss ich Dir noch ein paar kleine Scheißtexte zeigen, von der Art wie die zwei, die Du gesehen hast.“
Das Herabwürdigen des eigenen Tuns bildet einen wiederkehrenden Kontrast zu seinem ausgeprägten Perfektionismus, der zum Beispiel deutlich wird, wenn er bei den Theaterproben penibel auf jedes Detail achtet oder wenn er gegenüber Herausgebern, die seine Texte eigenmächtig kürzen, seinem Ärger in schärfsten, den Eklat riskierenden, Worten Luft macht – wie etwa in den Auseinandersetzungen mit Jean Paulhan oder mit Simone de Beauvoir.
Um auch bei den Übersetzungen seiner Werke die Kontrolle zu behalten, übersetzt er vieles aus dem Französischen ins Englische selbst, oder arbeitet mit seinen deutschen Übersetzern eng zusammen, zunächst mit Erich Franzen, später vor allem mit Elmar Tophoven.
Auch auf dem Theater fast alles abschaffen
Beckett, der das Theater revolutionieren sollte wie kein anderer, schrieb noch im Januar 1952, während der Schauspieler und Regisseur Roger Blin nach einem geeigneten Aufführungssaal für Warten auf Godot suchte: „Ich habe keine Ansichten zum Theater. Ich weiß nichts vom Theater. Ich gehe nicht hin. Das ist verzeihlich.“
Im Theater reduziert er die Bewegungsmöglichkeiten seiner Figuren, steckt sie bis zum Hals in Sandhügel, minimiert die Kulisse zunächst auf einen einzigen Baum, um in späteren Stücken auch auf das letzte Requisit zu verzichten. Er schafft den Regisseur ab, indem der Autor jedes Detail selbst bestimmt; er wird später auch die Schauspieler abschaffen und nur noch einen sprechenden Mund auf die Bühne stellen (Not I, 1972), oder er lässt den Text vom Tonband einspielen. Vorhang auf, ein kurzer Schrei vom Band, Einatmen, Ausatmen, ein zweiter Schrei vom Band, Vorhang zu, alles zusammen in 35 Sekunden (Atem, 1969) – weniger Handlung geht nicht, um nicht auch noch das Publikum abzuschaffen. Das erledigt Beckett schließlich, indem er gar nicht mehr für das Theater schreibt. Er wendet sich Hörspiel, Pantomime, Ballett und Film zu, freilich nur, um auch hier jeweils auszukundschaften, mit wie wenig die einzelnen Künste auszukommen in der Lage sind.
Aber ganz so weit sind wir am Ende von Band 2 der Briefausgabe noch nicht. Die letzten Briefe zeugen von seiner Arbeit am Endspiel (Fin de Partie; von ihm selbst ins Englische übersetzt als Endgame), das 1957 uraufgeführt werden sollte.
„Ich bin darauf gespannt, mein Stück zu sehen, damit ich ein bisschen genauer weiß, ob ich in dieser Richtung weitergehen kann oder ob ich völlig auf dem Holzweg bin“, schreibt er im Dezember 1956 an Jacoba van Velde. „Weder das eine noch das andere, scheint mir schon jetzt, das kann heiter werden.“ Wobei wir auch das Wort „heiter“ wörtlich nehmen dürfen. Es ist ein richtiger, ein konsequenter Weg, kein Holzweg, der in die Ausweglosigkeit führt.
Alle Gedanken scheinen in Sackgassen zu münden, in Aporien, so wie der Philosoph Sextus Empiricus (2. Jh. n. Chr.) es in umfassender Weise vorgeführt hatte. Dem radikalen pyrrhonischen Skeptiker dürfte Beckett auch bei der Lektüre Fritz Mauthners begegnet sein, dessen „Beiträge zu einer Kritik der Sprache“ er, wie er Hans Naumann berichtet, seinerzeit für James Joyce gelesen hatte. Ebenfalls an Naumann schreibt er: „Sie dürfen mich in die traurige Kategorie derer einordnen, die, wenn sie mit vollem Bewusstsein handeln müssten, überhaupt nicht handeln würden.“ (17. Februar 1954)
Nicht mehr handeln
In Ussy-sur-Marne, östlich von Paris, findet Beckett ein kleines Haus, in dem er sich aus dem Trubel der Großstadt zurückziehen kann. „Ich werkele missmutig vor mich hin. Heute einen Tisch aus Eichenabfällen zusammengebastelt. Noch steht er. Für meine Arbeit kann ich mich nicht erwärmen, ob Altes, Gegenwärtiges, Künftiges. Ich will nichts weiter als mich in diesem Rübenkaff vergraben, in der Erde wühlen, die Wolken anglotzen. Umschlossen von dicken Mauern.“

Becketts Haus in Ussy-sur-Marne – sein Rückzugsort vom Pariser Großstadtrummel ab 1953; Foto: Wolfgang Cziesla, April 2014
Vom Graben ist in diesen Briefen oft die Rede, eingraben, umgraben, und von Müdigkeit in allen ihren Facetten. „Ich bin regelrecht angewidert vom Schreiben, davon, wie ich schreibe“ – im September 1951 an Mania Péron, und im gleichen Brief, fünf Zeilen darunter: „Ein Stimmungstief, allerdings. Aber ich kenne nichts anderes.“
Als Akt ohne Worte I auf dem Marseille Festival d’Avant-Garde aufgeführt werden soll – seine erste Pantomime, mit der Musik seines Cousins John S. Beckett – schreibt er im Juni 1956 an seinen alten Freund Thomas MacGreevy: „[…] ich habe ziemlichen Horror vor den nächsten Monaten. Aber ich sage mir auch, dass ich sehr schnell in eine Art vertrödelte Trägheit verfalle, wenn es nicht diese Dinge gibt, die mich anstacheln.“
Ein Unglück, das man bis zum Ende verteidigen muss – den glücklich gewählten Titel der Briefausgabe, Band 2, hat der Suhrkamp Verlag einem Brief Becketts an Simone de Beauvoir aus dem September 1946 entnommen. Wobei man sich bei Beckett auch das „Verteidigen“ nicht allzu martialisch vorstellen darf. „Ich bin ein schlechter Kämpfer“, schrieb er im August 1948 an Georges Duthuit. „Vielleicht erreichen wir etwas mit Nichtkämpfenkönnen.“
Das „Bedürfnis, schlecht gerüstet zu sein“ (Le besoin d’être mal armé) gibt er gegenüber Hans Naumann als einen der Gründe an, warum er seine literarischen Werke nicht länger in seiner Muttersprache verfasst, sondern ins Französische wechselt, eine Sprache, in der er sich (zunächst) weniger sicher fühlte.
In frühen Jahren mochte Beckett als Sekretär und Mitarbeiter von James Joyce erfahren haben, dass das Idol seiner Jugend an Sprachmächtigkeit kaum überboten werden konnte. Womöglich lag ihm einiges daran, sich literarisch in eine Position zu bringen, die ihn vor Eitelkeit schützte.
Zwei weitere Bände wie den vorliegenden (von Chris Hirte mit sensiblem Sprachgefühl und profunder Sachkenntnis übersetzten) aus der sorgfältig editierten Cambridge-Ausgabe der Briefe Samuel Becketts dürfen wir noch erwarten – Band 3, wenn wir Glück haben, bereits in diesem Herbst.
Samuel Beckett: „Ein Unglück, das man bis zum Ende verteidigen muß. Briefe 1941–1956“. Aus dem Englischen von Chris Hirte. Suhrkamp Verlag. 819 Seiten, 45 Euro.