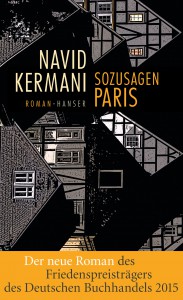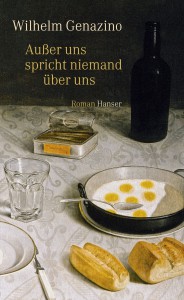Nichts als Überraschungen: Das Scala-Orchester mit starkem Auftritt im Konzerthaus Dortmund

Leidenschaftliche Einsätze: Riccardo Chailly leitet das Orchestra Filarmonica Della Scala. Foto: Petra Coddington
Impressionen eines Konzertes, die, so dahingewürfelt, seltsam klingen mögen. Doch gemach: Die Symbolkraft und Besonderheit der Beobachtungen wird sich alsbald erschließen. Also halten wir fest, dass Daniil Trifonov jetzt Vollbart trägt, dass die Zugabe dieses spannenden Nachmittages ein zeitgenössisches Stück ist – der Komponist sitzt im Saal – und dass Schumanns Musik teils wie von Fieber geschüttelt, teils ungewohnt introvertiert klingt.
Wir hätten das so nicht erwartet, bei diesem Gastspiel des Mailänder Orchestra Filarmonica Della Scala in Dortmunds Konzerthaus, am Pult der Chefdirigent, Riccardo Chailly. Andererseits gehört es ja zur Philosophie der Dortmunder Veranstalter, dem Publikum immer aufs Neue scheinbar Bekanntes im veränderten Klanggewand zu präsentieren. „Raus aus deinen Hörgewohnheiten“ ist das Motto. Nun, in diesem Konzert mit Schumanns „Manfred“-Ouvertüre, dem Klavierkonzert und seiner 2. Sinfonie ist das auf Eindrucksvollste gelungen. Nichts als Überraschungen, wohin sich Aug’ und Ohr auch wenden.
Beginnen wir mit dem Solisten. Der 25jährige Daniil Trifonov scheint aus seiner übervirtuosen Sturm-und-Drang-Phase schon herausgewachsen, technische Schwierigkeiten können ihm offenkundig kaum noch etwas anhaben, sein Spiel hat an Reife und Reflektion enorm gewonnen. Bei Schumann jedenfalls nimmt er sich extrem zurück. Versinkt in der Musik, artikuliert zartfühlend, wirkt wie ein scheuer Zeremonienmeister. Oder auch, die Assoziation sei ob des Bartes gestattet, wie ein Eremit, der ganz im Klang gefangen ist.
So einer will nicht auftrumpfen, nicht voller Überschwang durchs lebhafte Finale fegen. Stattdessen rhythmische Strenge, das Virtuose fest unter Kontrolle, auf dass der Satz ja nicht zu viel Gewicht bekomme. Schumanns Konzert atmet gewissermaßen romantische Clarté, hell im Klangbild und wie abgespeckt. Dies ist dem fulminanten Dirigat Chaillys zu danken: Nie wird das Klavier vom Mailänder Orchester zugekleistert, vielmehr hören wir eine dynamisch wunderbar ausbalancierte Musik.
Trifonov spielt Schumann im Geiste Chopins. Das mag nicht jedermanns Sache sein, wenn hier und da die gestelzte Dekadenz eines Salons durchschimmert, doch am Ende hat der Pianist das Publikum auf seiner Seite. Überraschung gelungen. Wie denn auch das Orchester staunen macht. Ein Klangkörper, der mit warmen Holzbläserfarben überzeugt, dessen Violinschmelz wohltönt, der überhaupt ungemein wach agiert auf Chaillys Dirigat. Der Chef der Mailänder ist ein Kapellmeister der alten Schule, ohne körperliche Verrenkungen und andere Marotten.
Und er ist, was nun die Aufführungspraxis angeht, ein Vollblutmusiker, der etwas wagt. Weil er, in Schumanns Ouvertüre und Sinfonie, nicht der Originalklangbewegung nachspürt, die ja längst in der Spätromantik angekommen ist, sondern vielmehr die Retuschen Gustav Mahlers verwendet. Und da geht es nicht um Kleinigkeiten, sondern um beherztes Eingreifen in die Originalpartituren. Da klingen plötzlich Blechbläser mit Dämpfer auf, die Schumann niemals verwendet hat, da tummeln sich allein 26 erste und zweite Geigen sowie neun Kontrabässe auf der Bühne. Eine großorchestrale Besetzung, als gelte es, bloß ordentlich Effekt zu machen.
Doch Chailly ist kein fahrlässiger Maestro am Pult, der es mal richtig knallen lassen will. Er stellt zur Diskussion. Und wenn in der „Manfred“-Ouvertüre das Klangbild hell und aufreizend funkelt, der musikalische Verlauf wie im Rausch vorüberflitzt, jede Beruhigung mehr Schein als Sein ist, wenn es schroff und wild zugeht, dann fällt es schwer, „ja, aber…“ zu rufen. Immerhin sei angemerkt, dass die Holzbläser oftmals kaum zu hören sind. Erst am Ende, wenn die Spannung nach und nach verebbt, Schumann (mit Mahler) auf Reduktion setzt, entdecken wir den balsamischen Klang von Flöten, Oboen oder Klarinetten.
Ähnlich geht es in der Sinfonie zu. Deren Hauptmotiv wird anfangs zwar noch etwas unstrukturiert vorgetragen, doch alsbald liegt alles so offen wie fiebrig und dynamisch exaltiert vor Ohren. Als Höhepunkt darf der langsame Satz gelten, dessen tristaneskes Sehnsuchtsmotiv sich ins Hymnische weitet. Da ist der Weg zu Bruckner nicht mehr fern. Dann wieder Atemlosigkeit im auftrumpfenden Finale, kraftstrotzend und roh wie bei Beethoven, teils in grenzwertiger Lautstärke. Alles vom Mailänder Orchester souverän gemeistert, präzise und mit unbedingter Leidenschaft. Überraschung erneut gelungen.
Doch damit nicht genug. Das Orchestra Filarmonica Della Scala tritt zur Zugabe an. Rasch huschen noch ein paar Musiker herbei, darunter das Personal für kleine und große Trommel sowie Becken. Sollten die Italiener als Rausschmeißer noch einen Rossini in Petto haben, serviert aus dem Mutterland der Oper? Weit gefehlt. Angekündigt wird Carlo Boccadoros „Fast Motion“. Eine vierminütige Raserei mit scharfen harmonischen Reibungen, teuflisch komplexer Rhythmik und in zumeist eminenter Lautstärke. Maschinenmusik wie von futuristischer Hand, garniert indes mit allerlei Jazzidiomatik. Ein neues Stück, wie sich herausstellt, der Komponist sitzt gerührt im Publikum, von vielen italienischen Fans frenetisch bejubelt. Überraschung gelungen: Hier, im Konzerthaus Dortmund, erklingt das Stück – eine Zugabe (!) – tatsächlich als deutsche Erstaufführung. Respekt.