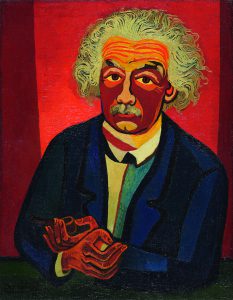Chopin mit Handbremse: Eine Wiederbegegnung mit dem Pianisten Alexej Gorlatch
Sein vielleicht spektakulärster Wettbewerbserfolg lag gerade ein Jahr hinter ihm, als Alexej Gorlatch seinen Einstand beim Klavier-Festival Ruhr gab. Der 1988 in Kiew geborene und seit 1991 in Deutschland lebende Pianist hatte beim ARD-Wettbewerb in München nicht nur den Ersten Preis, sondern auch den Publikumspreis und mehrere Sonderpreise gewonnen. Beim Klavier-Festival standen am 9. Juni 2012 im Harenberg City Center Dortmund Balladen von Johannes Brahms, Préludes von Claude Debussy und Etüden von Frédéric Chopin auf seinem Programm.
Anfang dieses Monats fiel Gorlatch die Ehre zu, eine Klavierabend-Serie im Konzerthaus Berlin zu eröffnen. Obgleich die Reihe nicht neu war, handelte es sich bei diesem Abend doch um eine Premiere. Denn die kleine, aber feine Veranstaltungsreihe der traditionsreichen Klavierbaufirma C. Bechstein musste überraschend umziehen, nachdem im Verkaufszentrum im Stilwerk an der Kantstraße plötzlich kein Platz mehr für sie war. Indes könnte sich das neue Domizil am Gendarmenmarkt als Glücksfall erweisen. Mitten in der Stadt gelegen und ohnehin ein starker Magnet für Musikfreunde, dürfen die Bechstein-Abende mit jungen Meisterpianisten nun im Kleinen Saal des Hauses Strahlkraft entfalten.
Gorlatch, seit dem Wintersemester 2016/17 Professor für Klavier an der Hochschule für Musik und Tanz in Frankfurt a.M., hatte für diese Gelegenheit ein reines Chopin-Programm gewählt. Er eröffnete den Abend mit der Polonaise-Fantaisie op. 61, deren freie Form ihm einige Probleme zu bereiten schien. Obgleich Gorlatch seinen lyrisch-schönen Klang aufscheinen ließ, verzettelte er sich im Geflecht der Mittelstimmen und schien Mühe zu haben, die Komposition auf einen Zielpunkt hin zu spielen.
Zwei Blöcke von jeweils 4 Mazurkas (op. 67 und op. 68) kamen dem Künstler an diesem Abend mehr entgegen. Hier konnte er einen warmen Erzählton entfalten, seine Spiellust in eine kleinere, überschaubarere Form fließen lassen. Warum der wechselnde Charakter dieser tänzerischen Kleinodien an diesem Abend eher kontrastarm blieb, warum Gorlatch häufig unfrei und steif wirkte, kann nicht schlussendlich erklärt werden. Fühlte der Künstler sich durch die aufzeichnenden Mikrofone gehemmt? Auf seinen ersten CDs hatte der Pianist sich als vorzüglicher Chopin-Interpret empfohlen.
Es dauerte bis zum berühmten Trauermarsch der Sonate Nr. 2 b-Moll, bis die Musikalität des einstigen Kämmerling-Schülers allmählich frei wurde. Mit dunkel brodelnden Bässen ging Gorlatch die Sonate an, löste sich nun auch allmählich von der bis dahin viel zu einheitlichen Dynamik. Der atemlose, quasi knochenlose Finalsatz jagte trefflich verwischt und verschwommen am Ohr vorbei. Wunderbar gefühlvoll gelang im Anschluss die Berceuse Des-Dur op. 57. Im sanften Wiegen-Rhythmus ließ der Pianist seine viel gerühmte Nuancierungskunst aufscheinen. Vor allem die Spieluhr-Lieblichkeit im Diskant ließ aufhorchen.
Das Scherzo Nr. 2 b-Moll glich im Anschluss mehr einem Brillier- als einem Nachtstück. Gorlatchs pianistisches Vermögen steht dabei außer Zweifel: Gewiss kann man dieses Stück auch von berühmteren Pianisten mit viel mehr falschen Tönen hören. Vielleicht war aber genau dies das Problem. Der Künstler schien kein Risiko eingehen zu wollen, zumindest nicht an diesem Abend in Berlin.
Wer sich in NRW ein Bild vom Spiel des Pianisten machen möchte, hat dazu übrigens bald Gelegenheit. Von Mitte Juni an wird der Künstler wieder in NRW gastieren: zum Beispiel im Teo Otto Theater in Remscheid (15. Juni 2017), im Theater und Konzerthaus von Solingen (16. Juni), im Theater Marl (17. Juni) und im Beethoven-Haus Bonn (1. August).
(Weitere Informationen auf der Website des Künstlers: http://alexej-gorlatch.com/aktuell/)