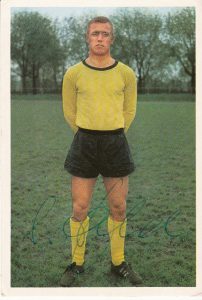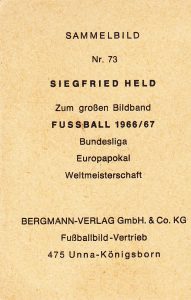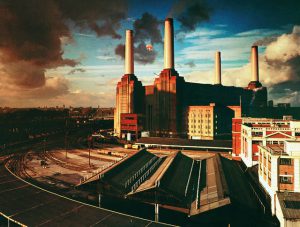In Wagners Welt: Marek Janowski dirigiert eine sensationelle „Rheingold“-Aufführung im Konzerthaus Dortmund

Götter unter sich: Loge (Daniel Behle), Donner (Markus Eiche), Froh (Lothar Odinius) und Wotan (Michael Volle, v.l.. Foto: Pascal Amos Rest)
So ist es wohl häufig im Leben: Große Momente pflegen sich nicht lautstark anzukündigen. Längst war bekannt, dass Dirigent Thomas Hengelbrock die Leitung der konzertanten Aufführung von Richard Wagners „Rheingold“ mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester aus Krankheitsgründen abgeben musste.
Im Voraus konnten sich womöglich enttäuschte Hengelbrock-Fans damit trösten, dass statt seiner Marek Janowski am Pult stehen würde, ein Opernmann durch und durch, in Sachen Richard Wagner so erfahren wie gefeiert. Auch hatte der Blick auf die Sängerbesetzung verraten, dass mit Michael Volle als Wotan und mit Johannes Martin Kränzle als Alberich Exzellentes zu erwarten sei.
Was sich dann aber abspielt im Konzerthaus Dortmund, der zweiten Station der bald in Baden-Baden endenden Aufführungsserie, gleicht einem Märchen. Denn in den folgenden zweieinhalb Stunden hören wir nicht einfach Musik. Vielmehr baden wir in goldgrünen Fluten, fliegen hinauf zu den Göttern, rasen in höllischer Fahrt hinab in Unterwelten und werden Teil eines phantastischen Spiels, in dem es um Alles geht, um Untergang oder Fortbestand der Welt. Wir sind nicht dabei, wir sind mittendrin.

Ein Opernmann durch und durch: Marek Janowski übernahm die Aufführungsserie für Thomas Henbelbrock. (Foto: Pascal Amos Rest)
Marek Janowski, das Elbphilharmonie Orchester und ein unglaublich stark besetztes Sänger-Ensemble haben uns komplett im Griff. So bestechend dicht ist diese Aufführung, so über die Maßen plastisch und bildhaft im Klang, dass sie filmische Qualitäten erreicht. Da wogen die Wellen, da lodern die Flammen, und 18 Ambosse auf der Chorempore hämmern uns – live! – den Sound von Nibelheim ins Ohr. Das Orchester klingt unter Janowskis Leitung wie ein Naturereignis: wogend und sausend, flirrend und brausend, gleichwohl niemals lärmend.
Nicht von dieser Welt scheint auch, was Michael Volle als Wotan und Johannes Martin Kränzle als Alberich vollbringen. Einen Göttervater mit solch überragender stimmlicher Autorität findet man kaum noch einmal. Das Volumen dieses Sängers lehrt das Staunen: Sein Wort, seine Stimme sind Gesetz. Johannes Martin Kränzle scheint als Alberich in die Fußstapfen des legendären Gustav Neidlinger treten zu wollen. So dämonische Züge er dem Schwarzalben einerseits gibt, so zeigt er ihn andererseits auch als bedauernswerten, stets verachteten Tropf. Seine warme, höchst facettenreiche Interpretation ist ein Lehrstück, wie aus Verbitterung allmählich Bosheit wird.
Welcher Hörgenuss auch vom Rest des Ensembles! Zum Beispiel von einer Fricka, die lyrisch-dramatisch singt statt hysterisch zu keifen (Katarina Karnéus), von einer Erda, die Wotan mit herrlich warm timbrierter Altstimme warnt (Nadine Weissmann), von zwei wunderbar stimmstarken Riesen (Christof Fischesser und Lars Woldt) und von drei Rheintöchtern, die Jubel und Übermut trefflich in Angstgeschrei und Klage umschlagen lassen (Mirella Hagen, Julia Rutigliano, Simone Schröder). Niemand stemmt, niemand forciert, niemand verfällt ins Deklamieren, auch nicht Donner und Froh, die ihre Kraft stets hell und leuchtend ins Spiel bringen (Markus Eiche und Lothar Odinius). Was macht es da schon, dass Elmar Gilbertsson als Mime ein wenig zur Überzeichnung neigt. Das letzte Wort behält Loge, der unstete Halbgott des Feuers. Daniel Behle gibt ihm wendige Eleganz, herrlich zwielichtigen Charme und die leisen Untertöne eines Zynikers, der sich stets ein Hintertürchen offen hält.
Ein laut jaulender Aufschrei der Begeisterung zerreißt die Stille nach dem Schlussakkord. Eine Männerstimme? Oder eine Frau? Wer weiß. Einen Wimpernschlag später toben auch die anderen los. Marek Janowski, in den Jahren 1975 bis 1979 GMD am Theater Dortmund, kehrt im größtmöglichen Triumph zurück.