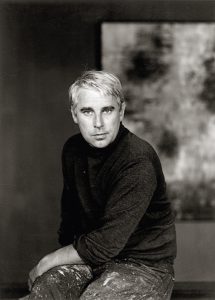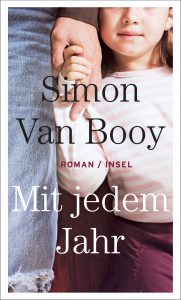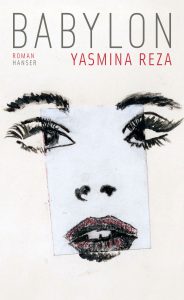Von 2017 bis 2019 leisten sich fünf Ruhr-Stiftungen für eine halbe Million Euro jährlich den Aufbau einer Außenstelle der lit.COLOGNE. Mit dieser Filialisierung verpasst die selbsternannte Metropole Ruhr erneut die Chance zu zeigen, was sie aus eigenen Kräften zu leisten imstande wäre. Statt eigensinnige Ansätze der Literaturförderung zu wagen und aus dem sich totlaufenden Event- und Kampagnenkarussell auszusteigen, wird Kölner Literatrubel dreist kopiert. Darin könnte auch eine Chance für selbstbewusste Literaturprojekte abseits des Rummels liegen.

Programmveröffentlichung bei der lit.RUHR.
(v. r. n. l.): Rainer Osnowski (Festivalleiter lit.RUHR), Jolanta Nölle (Vorstandsmitglied Stiftung Zollverein), Traudl Bünger (Künstlerische Leiterin lit.RUHR), Daniela Berglehn (Pressesprecherin der innogy Stiftung), Eva Schuderer (Programm lit.RUHR), Bettina Böttinger (Moderatorin), Thomas Kempf (Vorstandsmitglied der Krupp-Stiftung), Tobias Bock (Programm lit.RUHR)
Foto: © Heike Kandalowski, lit.RUHR
Viel zu lange haben es sowohl Kulturpolitik als auch Unternehmen und Stiftungen längs der Ruhr versäumt, Literaturförderung beherzt so zu unterstützen, dass sich mehr gute Ideen bis zur Projekt- oder Bühnenreife hätten entwickeln lassen.
An Konzepten wie dem zum Europäischen Literaturhaus Ruhr, zum Literaturnetz Ruhr, zur Stadtschreiber-Residenz oder zur Fortführung des Schulschreiber-Modellversuches herrschte kein Mangel. Viele klopften damit als bittstellende Buch- und Bettelmönche an die Türen der Internationalen Bauausstellung Emscherpark, der Kulturhauptstadt-Macher, der RAG-Stiftung oder des Regionalverbandes Ruhr.
Konzepte leichthin abkupfern
Doch hiesige Geldgeber scheinen guten Ideen, die aus der Region kommen, abgrundtief zu misstrauen. Sie fürchten schlicht jenes dräuende Mittelmaß, das ihnen aus der eigenen Arbeit so wohl vertraut ist. Niemand wollte Interesse daran bekunden, behutsam Qualität aufzubauen, konnte man doch leichthin Kulturtourismus-Konzepte anderswo abkupfern – zuletzt ging es so zum Shoppen auf nach Köln.
Mit dem Ankauf des hochglänzenden lit.COLOGNE-Ablegers lit.RUHR – so hoffte wohl eine dezent agierende „Elite“ – bekäme man über den Hintereingang doch noch Zutritt ins austauschbare Event- und Marketingbusiness großer Vorbild-Metropolen wie Berlin, London, New York. Dass angesichts solch öden Kopisten-Coups wirklich schöpferischer und inspirierender Austausch im öffentlichen Leben des Ruhrgebiets nicht vermisst wird, zeigt bereits, wie ruiniert jede Debattenkultur hierzulande ist.
(Ach, Ruhrgebiet, du sick apple. Gestern Abend ging ich durch Essens Kettwiger Straße und dachte: Wer es hier nicht schafft, schafft es nirgendwo. Bin ich wirklich der Einzige ohne Bierflasche in der Hand?)
Simulation statt Stimulation
Um Missverständnissen vorzubeugen: Über die lit.RUHR und deren Glamour-Mäntelchen ist zu sprechen. Infrage steht aber ebenso eine ideenlose Literaturpolitik, die lebendiges literarisches Leben weder gestalten kann noch fördern will. Statt genau dieses Leben zu stimulieren, wird es immer nur simuliert.
Infrage steht die Arroganz reicher Ruhr-Stiftungen, die besser zu wissen wähnen, was das literaturinteressierte Publikum wünscht. Infrage steht ihre als „gut gemeint“ deklarierte, aber schlecht gemachte Modernisierung von oben, vom grünen Sponsor-Tisch aus. Infrage steht mit diesen Stiftungen und deren Vorständen, Kuratorien, Juristen aus Wirtschaft und Politik eine eitle Literaturförderung nach Gutsherrenart, die sich qua Kultur vor allem dem Standortkonkurrenz-Denken und der Politikrepräsentation verpflichtet fühlt (zu dieser Mentalität s. auch FAZ).

Pressekonferenz lit.RUHR
Foto: © Heike Kandalowski, lit.RUHR
Mit beschränkter Haftung
Zurück zunächst aber zur geschäftstüchtigen lit.COLOGNE-GmbH (und dem ihr eng verbundenen gemeinnützigen lit e.V.). Hochprofessionell hat man in Köln Denkfaulheit und Geltungssucht an der Ruhr genutzt, um einen Marken-Klon namens lit.RUHR zu platzieren und sich dabei exorbitant subventionieren zu lassen. Allerdings darf man dies Verein und GmbH nicht ernsthaft vorwerfen.
Die lit.COLOGNE hat so eine zweite Abspielstätte gefunden, hat allen Fensterreden zum Trotz aber über die Eigenart des Ruhrgebiets bisher nicht wirklich nachgedacht. Schade, dass mit der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, der Brost-Stiftung, der RAG-Stiftung, der innogy Stiftung sowie der Stiftung Mercator gleich fünf Stiftungen der Versuchung nicht widerstanden, an der lit.COLOGNE anzudocken.
Sehr gekonnt gepanschter Wein in gebrauchtem Schlauch
Kaum etwas an der lit.RUHR überrascht, die meisten Schauspieler, Moderatoren, Musiker und – nicht zu vergessen – Autoren waren längst zu Gast an der Ruhr. Zugegeben, Literaturveranstalter kochen überall nur mit Wasser und selbstverständlich werden auch der lit.RUHR gute Abende gelingen.
Schließlich hat er Hochkonjunktur, dieser im deutschen Sprachraum sich überbietende Eventzirkus: vom ‚internationalen literaturfestival berlin‘ über ‚Harbour Front‘ in Hamburg und „Leipzig liest“/“Zürich liest“ bis hin zur Frankfurter Buchmesse, zum Erlanger Poetenfest oder all den Crime-Festivals landauf landab. Viele dieser Festivals sind zum Erfolg verdammt, auch ökonomisch. Und wo Erfolg sich nicht einstellen will, redet man ihn über PR-Arbeit herbei.

Heinz Strunk: Kommt zur lit.Ruhr und war letztes Jahr Gast der Reihe“ausgebootet“ im Katakombentheater Essen; Copyright-Foto: Jörg Briese
Gut aufgestellt? Schlecht nachgestellt!
Angesichts dieser Festivalitis und Überfülle nähme die lit.RUHR den Mund allerdings sehr voll, wenn sie irgendein „Alleinstellungsmerkmal“ auch nur ansatzweise behaupten wollte. Beileibe nicht nur die IKIBU Duisburg, die Internationale Kinderbuchausstellung, stellt seit Jahrzehnten Kinder- wie Jugendbuchautoren aus aller Welt vor und kämpfte immer mal wieder ums Überleben. Auch Jugendstil, das Dortmunder Kinder-und Jugendliteraturzentrum NRW, unterstützt vehement das Engagement für „kreative Literaturvermittlung und Leseförderung“.
Nun also liest auch die lit.kid.RUHR den Jüngeren was vor, das ist sehr lieb, aber beileibe nichts Unerhörtes, zumal trotz Förderung durch die Brost-Stiftung nicht einmal dies kostenlos zu sein scheint. Und in Gelsenkirchen durfte eine Jungautoren-WG aus Studenten des Literaturinstituts Leipzig sogar fünf Wochen lang das Ruhrgebiet erkunden und beschreiben. Schön für die Transitreisenden, doch auch nur wunderbar kalter Kaffee. Die Katholische Akademie in Mülheim hat so etwas unter dem Projekttitel „Metropolenpilger“ bewerkstelligt – und auch sie war damit nicht die Erste oder Einzige.

„Morgenstund hat Gift im Mund“: Sophie Rois las auf Einladung des Literaturbüros im Ringlokschuppen gallige Texte Dorothy Parkers; Foto: © Jörg Briese
Permanente Revolution
Ende August 2017 gingen die lit.COLOGNE SPEZIAL und die lit.RUHR gleich mit zwei zum Verwechseln ähnlichen Pressemitteilungen/Programmvorstellungen in Köln und Essen ins Festival-Windhundrennen. Wer es vom 3. bis zum 15. Oktober 2017 nicht schaffen sollte, Zadie Smith, Donna Leon, Sven Regener, Ulla Hahn oder Uwe Timm in Köln zu erleben, kann sie vom 4. bis 8. Oktober im Ruhrgebiet sehen und hören. Nicht nur jene Fans wird das freuen, die an der Ruhr bereits bei einem der vielen Auftritte dieser Autoren dabei waren.
Allein Zadie Smith war im Revier nie zu Gast, jeder aber kennt Donna Leon, die einst sogar in der Stadtbücherei Gladbeck las, später trat sie mehrmals bei „Mord am Hellweg“ auf. Auch Robert Menasse kommt zur lit.RUHR. Bei seinen drei Auftritten für das Literaturbüro Ruhr war er immer ein sehr kluger, liebenswerter Gast; etwa als er seinen Essayband „Permanente Revolution der Begriffe“ im Essener Grillo-Theater vorstellte.
Anteasern und wiederkäuen
Apropos Revolution in Permanenz: In der Tat wenig Lust auf die lit.RUHR macht einer der Video-‚Teaser‘ auf Youtube. Mariele Millowitsch nuschelt da vor Kölner Lärmkulisse so über die lit.RUHR hinweg, als ob diese längst gelaufen wäre. Sprachlich ergiebiger dürfte dagegen die Eröffnungsgala der lit.RUHR werden. Neben Iris Berben, Christoph Maria Herbst, Bettina Böttinger, Max Mutzke sind sogar zwei Literaten zu hören, einer davon Wladimir Kaminer, auch ihn kennen viele von seinen Lesungen im Ruhrgebiet.
Die Eintrittspreise für einen Platz bei der Eröffnungsgala liegen zwischen 24 und 56 Euro. Nicht auszudenken, wie hoch sie lägen, wenn nicht fünf Ruhrstiftungen die lit.RUHR mit 500.000 Euro gesponsert hätten. Wofür gibt man diese Summe plus der Einnahmen durchs Ticketing wohl aus? Die Honorarkosten des diesjährigen Programms scheinen eine solch hohe Summe kaum herzugeben, zumal durch Mehrfachauftritte in Köln und an der Ruhr sowie die Sponsoren einiges an Fahrt-und Hotelkosten eingespart werden dürfte. Doch sicher werden viele Tausender auch in die Werbung und die Infrastruktur gehen müssen, um im Ruhrgebiet einen Hype um die lit.RUHR erstmals zu entfachen.

Ziemlich versteckt: Landschaftspark Duisburg-Nord, das 2010-Publikum der Grass-Lesung des Literaturbüros Ruhr. Foto: © Jörg Briese
Schelte und Ignoranz
Dabei sollte mit der lit.RUHR alles ganz anders werden. Wie meinte in der WAZ Essen die „Vorsitzende der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Stiftung Zollverein und seit langem ein Fan der lit.Cologne“, wie also sprach Dr. Anne Rauhut, die die spannende Vielfalt der Lesungen und Literaturgespräche vor Ort nicht zu kennen scheint und also die lit.COLOGNE ins Revier lockte: Vieles sei „zu versteckt und relativ weit weg von den Menschen“, findet Rauhut.
Ein Lesefest wie die lit.RUHR, so Rauhut weiter, sei eine „gute Mischung aus Anspruch und Unterhaltung“, eine große Bühne, auf der Fußball und Musik genauso Platz haben wie Tolstoi und Tucholsky. ‚Man muss die Hemmschwellen niedriger legen‘, meint Rauhut.“ Gratulation, Letzteres scheint nun gelungen. Fehlen auf der Bühne eigentlich nur noch Carmen Nebel und ein Pony. Aber wer weiß?
Fehlgriff Stadtschreiber Ruhr, Glücksgriff Gila Lustiger
Nun aber wirklich Schluss mit der Kritik an der lit.RUHR, ihrem Marketing-Sprech, ihrem rasenden Event-Stillstand. All das hat die Ruhr-Stiftungen nicht davon abgehalten, die lit.COLOGNE auch noch zu Beratern des frisch installierten Stadtschreiber Ruhr-Projekts zu machen. Die gute Nachricht war: Gila Lustiger wird erste Stadtschreiberin Ruhr; die schlechte: Die Kölner „lit.Cologne berät“ – so die WAZ – beim Stadtschreiber-Projekt die Essener Brost-Stiftung.
Jens Dirksen, Kultur-Chef der WAZ, war in seinem Print-Artikel so freundlich zu erwähnen, dass das Literaturbüro und die Literarische Gesellschaft Ruhr seit Jahren eine Stadtschreiber-Residenz fordern. Niemand hat allerdings hingehört. Nun machen Brostens dabei erneut diskret-gemeinsame Sache mit der lit.COLOGNE.
Bodo Hombach formulierte erläuternd: „Im Ruhrgebiet ist eine reiche menschliche, kulturelle und historische Schatzsuche möglich.“ Was mag das sein, eine ‚menschliche Schatzsuche‘? Das Gegenteil einer ‚unmenschlichen Schatzsuche‘? Hombach möchte wahrscheinlich sagen, dass es auch an der Ruhr großartige Menschen zu entdecken gäbe, wenn man denn hinsähe. Da hat er allerdings recht.
„Wir müssen draußen bleiben“
Doch auch beim Stadtschreiber-Projekt hat man davon abgesehen, Autoren, Kritiker, Literaturwissenschaftler oder Literaturveranstalter aus der Region einzubeziehen. Wiederum borgt man sich das, was man für Kompetenz hält, aus der karnevalesk schillernden Ruhrmetropole Köln (die so gerne wie Berlin wäre).
Von Balance und dem rechten Maß kann nirgendwo mehr die Rede sein: hier der Tribut der Stiftungen für die lit.COLOGNE, dort die Missachtung der Literaturförderer vor Ort. Sprach nicht der Philosoph Odo Marquard einst von Inkompetenzkompensationskompetenz?

„Mehr Licht“ forderte völlig vergeblich Günter Grass bei seinen 2010er-Lesungen fürs Literaturbüro Ruhr in Bochum und Duisburg.
Kampagne – von „campagne“: „Feldzug“
Konfuse Kulturpolitik im Ruhrgebiet hat ohne Not kapituliert, sich selbst entmündigt und große Teile konzeptioneller Eigenständigkeit aus der Hand gegeben. Obszön ist das, im ursprünglichen Sinn des Wortes, beschämend für alle Beteiligten.
Woher kommt sie, diese Dominanz des Herumprotzens mit dem Fetisch ‚Festival‘, mit dem Irrglauben an dessen zwingenden Erfolg und überragende Außenwirkung? Als ob es im Ruhrgebiet nicht bereits ernüchternde Erfahrungen mit Kampagnenpolitik, deren bösen Folgen oder deren Verpuffen gegeben hätte. Überfällig, dies endlich zu evaluieren; nur bitte nicht weiter von jenen, die solche Kampagnen selbst inszeniert haben.
Statt Literatur zu lesen, darüber in Muße nachzudenken und sich in Gesprächen öffentlich auszutauschen, werden mit der Festivalisierung der Stadtpolitik Kunst und Kultur weiterhin vor den Karren von Marketing und Politik gespannt. Dabei vernachlässigt man gern auch die äußerst unterschiedlichen strukturellen Rahmenbedingungen Kölns und des Ruhrgebiets.
Das Ruhrgebiet ist Flächen- und Splitterstadt, es fehlt an großen Sendern, Verlagen, es fehlt trotz guter Journalisten an einem international ausstrahlenden Feuilleton und all jenen Medienmenschen, Kritikern, Autoren, die in Köln dafür sorgen, dass die lit.COLOGNE mediale Schaufenster ins Bundesweite hat. Immerhin: Für die lit.RUHR hat man wichtige ‚Medienpartner‘ wie WDR und Funke-Medien gewonnen, dies dürfte zumindest garantieren, dass unabhängige Eventkritik nicht stattfindet.

2014: US-Autor Stewart O’Nan als Gast von lit….. äh… des Literaturbüros Ruhr; Foto: © Jörg Briese
Ruhrgebiets-Bashing
Wobei neben der Eventkritik auch Diskursanalyse bitter nötig wäre. Michel Foucault hatte einst über sie nachgedacht, jene unausgesprochenen Regeln, die beeinflussen, was wie wann von wem zur Sprache gebracht werden kann und was nicht. Vielleicht ließe sich so erklären, warum Rainer Osnowski von der lit.COLOGNE im Rahmen seiner Vorankündigungsrhetorik in der Kölnischen Rundschau verlauten ließ: „Im Ballungsraum Ruhrgebiet mit rund fünfeinhalb Millionen Einwohnern sollen „erstmals Autoren auftauchen, die daran bislang vorbeigegangen sind“. Das interessiere auch jene Verlage, „für die das Ruhrgebiet bislang noch Diaspora ist‘.“
Wer austeilt, sollte auch einstecken können: Alles, was man im Leben braucht, sind Ignoranz und Selbstvertrauen, heißt es bei Mark Twain – und davon hat Osnowski anscheinend reichlich. Bös missglückte ihm aus enger Kölner Perspektive die Werbung für die lit.RUHR gleich zu Beginn. Um die lit.RUHR aufzuwerten, griff er zur Entwertung des literarischen Lebens an der Ruhr.
Mit osnowskischer Geringschätzung und Erlöserpose treten Missionare auf, nicht aber Förderer der Literatur, die doch Kenner und Könner der Sprache sein sollten. Zwischen Duisburg und Dortmund würde man noch mehr Osmose durch internationalen Austausch der Künste und Künstler durchaus begrüßen, auf die lit.RUHR aber und Großformate ohne Format könnte man gut und gern verzichten.
Keine Fixierung auf die lit.RUHR, sondern Eigensinn ganzjährig stärken
In diesen Zeiten der postdemokratischen Kultur- als Symbolpolitik kann allen Literaturliebhabern an der Ruhr in heiterer Verlassenheit nur geraten werden, ihre eigenen und eigensinnigen Projekte weiter voranzutreiben (viele davon habe ich für die ‚Revierpassagen‘ recherchiert). Und: Warum sollte man sich beim Tanz ums goldene Festival-Kalb überhaupt abstrampeln? Kraft und Fantasie kostet das und mit jeder Überdosis Organisation verkümmert schnell die Lust am Lesen.
Nervtötend ist zurzeit deshalb auch die Dauerfrage, warum denn die ‚literarische Szene‘ an der Ruhr (was soll das sein?) nicht selbst ein ‚hochkarätiges‘ (drunter geht’s nicht) Festival auf die Beine gestellt habe. Ganz einfach: Viele investieren hierzulande all ihr beharrliches Engagement, manchmal auch einen Teil ihres Geldes in die eigenen Projekte der Literatur- und Leseförderung, des Zeitschriftenmachens oder internationalen Austauschs – damit haben sie mehr als genug zu tun. Niemand von ihnen könnte nebenbei auch noch die ‚Szene‘ dauerhaft vernetzen oder ein Festival organisieren. Und vor allem: Kaum jemand will das. Warum auch? Siehe oben.

Heinz Helle & Hubert Winkels zu Gast bei „Über Leben! Von der Hoffnung auf Zukunft“ – September 2017, Medienforum Bistum Essen
Kleine Volte: Hoch lebe die lit.RUHR!
Die lit.RUHR kommt so sicher wie das Amen im Essener Dom und für vier Tage im Jahr wird sie ihr ganz eigenes Publikum finden: Und? Mögen doch „Hannelore Hoger, Richie Müller und die Gummi-Ente“ (Programmbeilage der lit.RUHR) im schadstoffarmen Diesel des Sponsors Mercedes zu ihrem Auftritt „Fetisch“ (7.10., Zollverein) fahren, ihre „literarische Expedition in die Welt des Fetischismus“ starten und danach erschöpft ins Kissen der Hotel-Suite des Sponsors Sheraton sinken. Wieder ein – sagen wir mal – bunter Rezitationsabend, den man nicht selbst veranstalten musste (Verzeihung, verehrte Frau Hoger).
„Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt, daß der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, daß es Zeit wird.“ So heißt es in Paul Celans Gedicht „Corona“. Man darf das UNIFORMAT „FESTIVAL“ getrost der lit.RUHR und ihren Gönnern überlassen und … abhaken.
An der Zeit wäre es allerdings, im Ruhrgebiet die Förder-Balance nicht noch weiter zu verlieren und ideell wie finanziell endlich Initiativen zu ermutigen, deren nachgewiesene Kompetenz es verdient hätte. Aber dafür werden Sachverstand, Mut und Geld bei den Stiftungen wohl nicht ausreichen – von Kommunen und RVR ganz zu schweigen.
_________________________________________________________
Gerd Herholz, der Autor des Beitrags, ist langjähriger Wissenschaftlicher Leiter des in Gladbeck angesiedelten Literaturbüros Ruhr. (Anm. d. Red.)