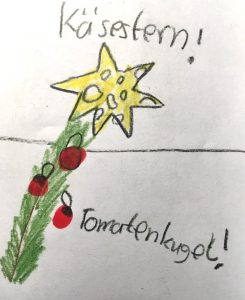Barbara Hannigan dirigiert stets ohne Taktstock. Foto: Pascal Amos Rest
Sie dirigiert ohne Taktstock, ihre Arme reichen weit in den Raum hinein, in ständiger, oft rotierender Bewegung, als drehe sie an einem großen, imaginären Klangrad. Ein wenig hemdsärmelig wirkt das bisweilen, doch überwiegt der Eindruck des steten Fließens im Fortgang der Musik, gespeist aus tänzerischer Körpersprache.
Wenn Barbara Hannigan, exzellente Sopranistin und seit 2010 auch Dirigentin, sich der tönenden Emotionalität hingibt, wird ihre Zeichengebung entsprechend ausladender. Gezielte Einsätze für bestimmte Instrumentengruppen müssen dann der Wirkmacht des Ganzen weichen. Der Sinn für Details ist gleichwohl ausgeprägt, wie auch Hannigan bei stark rhythmisierten Passagen verbindlicher führt, mit kleinteiligerer Gestik.
Im Konzerthaus Dortmund hat nun die kanadische Künstlerin mit der Wunderstimme fürs moderne Fach, mit Sinn fürs Wagnis, ohne klassische Dirigierausbildung für sich das Pult zu erobern, das große Staunen entfacht. Weil Barbara Hannigan den Takt vorgibt und gleichzeitig singt, und dies mit einer kessen Selbstverständlichkeit, die an Chuzpe grenzt. Und weil sie, im Falle von George Gershwins „Girl Crazy“-Suite, reichlich Showtalent beweist, um das Publikum von den Stühlen zu holen. Wobei dringend hinzugefügt werden muss, dass das niederländische Orchester namens Ludwig, ein Klangkörper von gehöriger Qualität, daran beherzt mitwirkt.
„Ludwig”, erst 2012 gegründet, hat in seinem Bestreben, mit außergewöhnlichen Programmen, ja ausgefeilten Konzepten den konzertanten Routinebetrieb aufzubrechen, in Hannigan eine risikofreudige Mitstreiterin gefunden. Und so erklingt in Dortmund zunächst „Syrinx“ für Flöte solo von Claude Debussy, Arnold Schönbergs „Verklärte Nacht“ in der Streichorchesterfassung sowie die „Lulu“-Suite Alban Bergs, ehe Gershwins vertraute Songs aufblitzen. Freilich: Alle Werke blicken auf Frauengestalten und deren Geschichten in verschiedenster Couleur, wobei es nicht um Nacherzählung, sondern um die Darstellung emotionaler Befindlichkeiten geht. Und am Ende wissen wir, „Girl Crazy“ ist eines von Hannigans markanten Markenzeichen. Ja, ein wenig verrückt wirkt dieser Abend.
Dabei beginnt alles sehr sanft, geschmeidig, wohltuend ruhig. Ingrid Geerlings gestaltet wunderschön, mit langem Atem und in feiner Differenzierung Debussys Flötenstück um die Nymphe Syrinx, die vor den Nachstellungen Pans flieht, sich in ein Schilfrohr verwandeln lässt, das Pan wiederum zur Flöte formt. Die Musik fließt frei, gewinnt an Dringlichkeit, um sich allmählich zu verlieren. Ganz dunkel ist der Saal, um die mythische Wirkung des Klangs zu verstärken. Magisch, bei aufkeimender Helligkeit, gelingt sodann der nahtlose Übergang zu Schönbergs „Verklärter Nacht“.

Singen und dirigieren zugleich: Barbara Hannigan gibt alles. Foto: Pascal Amos Rest
Auch hier sanfter Beginn, mit einer absteigenden Figur, die indes ziemlich finster wirkt. Abrupte dynamische Wechsel, zunehmendes Tempo, bisweilen aggressiv flirrende Tremoli und harsche Klänge geben dem Stück enorme Dramatik. Dann plötzlich lichtet sich die Szenerie, feine Silberfäden ertönen, eine zunehmend (ungebremste) emphatische Stimmung gewinnt die Oberhand.
Schönberg komponierte pure Emotion, noch weit entfernt von seinen 12-Ton-Konstrukten, im Sinne des Dichters Richard Dehmel. Dessen Versvorlage schildert die Beichte einer Frau, die ihrem Geliebten gesteht, von einem Fremden schwanger zu sein. Ihre Angst schwindet indes, als der Geliebte versichert, das Kind wie sein eigenes aufziehen zu wollen. Das Orchester wiederum kann diesen Schwebezustand zwischen Bangen und Hoffen stark umsetzen, wenn auch mit kleinen rhythmischen Schwächen. „Ludwig” schwelgt in satten und fahlen Streicherfarben, der letzte Zauber der Verklärung aber bleibt uns das Ensemble schuldig.
Umso wuchtiger, von elementarer Kraft, tritt es uns, erweitert um Bläser, Harfe und Schlagwerk, mit Bergs „Lulu“-Suite entgegen. Das fünfteilige Extrakt aus der gleichnamigen Oper atmet sowohl hymnische, dekadente Sinnlichkeit als auch die Düsternis des katastrophischen Finales (Lulu wird von Jack the Ripper erstochen). Inmitten das Lied der Lulu, von Barbara Hannigan mit elastischer, höhensicherer Stimme gesungen.
Doch sogleich wird evident, dass singen und dirigieren eine nahezu unmögliche Kombination ist. Die Bewegungen der Frau am Pult wirken unschlüssig in ihrer Mischung aus Orchesterleitung und Rollencharakterisierung. Mit zumindest einer gravierenden Folge: „Ludwig” ist zu laut, die dynamische Balance stimmt nicht. Das gilt auch für die Gershwins-Songs, obwohl Hannigan sich inzwischen mit Mikroport verstärkt hat. Das Ensemble ist einfach zu pompös besetzt. Bergs Suite kommt im übrigen etwas pauschal daher, manche motivische Facette bleibt unterbelichtet, die Eruptionen überwältigen nicht, sind vielmehr demonstrativ wuchtig.
Aber letzthin läuft sowieso alles auf die Gershwin-Show hinaus, mit dem finalen Hit „I got rhythm“. Dann stilisiert sich die singende Dirigentin zur triumphierenden Hollywood-Ikone, die Hand zum Himmel gestreckt. Fixe Rhythmik, Lautstärke und Pose – das hat noch immer gereicht, das Publikum aus der Reserve zu locken.
Ungeachtet dessen ist Barbara Hannigan eine nicht unbedeutende Symbolfigur für die stärker als zuvor ins Bewusstsein rückende Tatsache, dass viele Frauen entschlossen und mit Erfolg Kurs nehmen auf das Pult vor dem Orchester. In Wuppertal ist Julia Jones Chefin, Joana Mallwitz wird Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg, Mirga Grazinyté-Tyla hat jüngst im Konzerthaus Dortmund mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra eine außergewöhnliche „Pastorale“ dirigiert. Um nur eine klitzekleine Auswahl zu nennen.