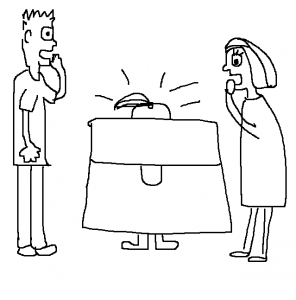Verlöschensklänge: Das Orchestre de Paris kombiniert in Dortmund Werke von Jörg Widmann und Gustav Mahler

Solist Antoine Tamestit war von Beginn an eng in den Entstehungsprozess des Bratschenkonzerts von Jörg Widmann eingebunden. (Foto: Pascal Amos Rest)
Daniel Harding und Antoine Tamestit waren sich einig. Wenn überhaupt ein Werk vor der 9. Sinfonie von Gustav Mahler gespielt werden könne, dann das Konzert für Viola und Orchester von Jörg Widmann, meinten der Dirigent und der Bratschist.
Im schmerzlich-innigen Ausklang des Stücks, das 2015 im Auftrag des Orchestre de Paris entstand, sehen beide den perfekten Brückenschlag zu Mahlers letzter vollendeter Sinfonie. Wenn Widmann in den letzten Takten die Spätromantik samt ihrer Brüchigkeit, Fragmentierung und Überdehnung beschwört, dann scheint Mahlers Neunte um die Ecke zu lugen: eine Sinfonie, die sich auflöst in ihre Bestandteile, die nach rund 80 Minuten zögernd und langsam erstirbt. Eine Musik des Verlöschens.
Wie angemessen, ja nachgerade natürlich diese Werkfolge klingen kann, bewiesen Harding, Tamestit und das Orchestre de Paris jetzt im Konzerthaus Dortmund. Widmanns Bratschenkonzert gleicht einer klanglich reizvollen Reise, in der Chinesisches, Arabisches und Jüdisches mitschwingt. Zu Beginn schlägt Widmungsträger Antoine Tamestit viele Minuten lang Pizzicato-Kaskaden aus seinem Instrument, als habe er das Ziel, berühmten spanischen Gitarristen Konkurrenz zu machen. Dann beginnt er, zwischen den Orchestergruppen umher zu wandern: sucht Anschluss an die Bassflöte, erschrickt vor den rülpsenden Einwürfen der Tuba, wirft sich in einen virtuosen Wettstreit mit der Pauke und animiert die Streicher zu flirrenden Glissandi.

Antoine Tamestit wandert während des Spiels zwischen den Instrumentengruppen des Orchesters umher (Foto: Pascal Amos Rest).
Aber es sind weder musiktheatralische Effekte à la Kagel noch Geräuschhaftigkeiten à la Lachenmann, die uns packen und nicht mehr loslassen. Vielmehr wird hier mit höchster Überzeugung und bestechendem Können musiziert. Wer Neue Musik für spröde und verkopft hält, erlebt bei diesem sinnlichen Klangpanorama sein blaues Wunder. Den Ausklang gestalten Tamestit und das Orchester als intensive Klage.
Was für Teufelsmusiker es sind, die Daniel Harding nur noch bis Sommer dieses Jahres als Chefdirigent leiten wird, zeigt sich dann auch in Mahlers 9. Sinfonie. Nicht genug damit, dass sich Bläsereinsätze wie aus dem absoluten Nichts im Raum kristallisieren. Sie sind so subtil, dass es fassungslose Sekunden braucht, um die Klangquelle überhaupt benennen zu können. Oboe und Flöte, Klarinetten und Hörner, Piccoloflöte und erste Geigen verschmelzen in perfekter Intonation zu unvergleichlichen Farben. Daniel Harding gestaltet das „Andante comodo“ zu einer riesigen Sehnsuchtsmusik. Alles ist Drängen in diesem ersten Satz: Aber das Schlachtgetümmel der früheren Sinfonien, die triumphalen Apotheosen hat diese Neunte weit hinter sich gelassen.
Harding versteht sich bestens auf die Elemente von Mahlers Tonsprache: auf das bauernhaft Grobe, das Einfältige und Banale, das höhnisch Meckernde, das Feierliche und das Schönheitstrunkene. Er hält das Orchester unter Spannung, dabei übergroße Lautstärken vermeidend. Noch einmal beschwört er im letzten Satz „die allmächtige Liebe“, wie sie der Pater Profundus in Mahlers 8. Sinfonie besingt. Schließlich erblasst das abschließende Adagio, wird jenseitig fahl, ja brüchig. Harding hält diese morbide Textur mit feinem Fingerspitzengefühl, scheint zuzusehen, wie die Fäden sich auflösen, lauscht voraus in die Stille, in die diese Musik unweigerlich einmünden muss. Das versteht auch das Konzerthaus-Publikum, das die Sinfonie zuvor schon zweimal durch Applaus unterbrechen wollte. Lange rührt sich nach dem letzten Ton keine Hand. Dann bricht der Jubel los.
Antoine Tamestit wird am 19. und 20. April erneut im Konzerthaus Dortmund zu erleben sein: mit einem öffentlichen Meisterkurs sowie einem Liederabend mit Christiane Karg.
(Der Bericht ist zuerst im Westfälischen Anzeiger erschienen. Informationen: http://www.konzerthaus-dortmund.de, Ticket-Hotline 0231/ 696 200.)