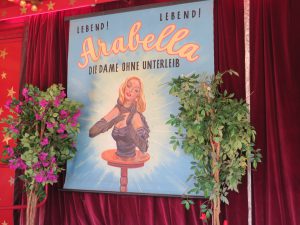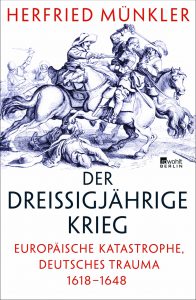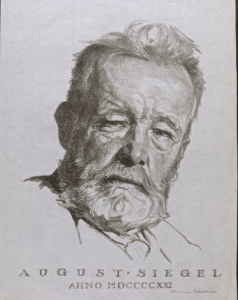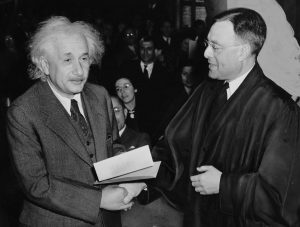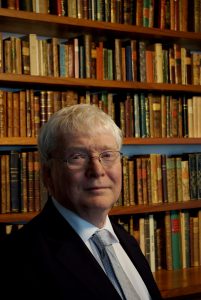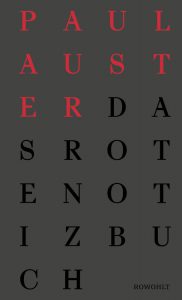„Intuitive Kommunikation wie in der Familie“ – Lambert Orkis ist seit 30 Jahren Klavierbegleiter von Anne-Sophie Mutter
Gastautor Robert Unger (Pressesprecher beim Kurt Weill Fest Dessau) im Gespäch mit Lambert Orkis, Experte für historische Instrumente und seit dreißig Jahren Klavierpartner der Geigerin Anne-Sophie Mutter:
Lambert Orkis ist ein international anerkannter Kammermusiker, Interpret zeitgenössischer Musik und Experte für Aufführungen auf historischen Instrumenten. Seit 1988 tritt er als Klavierpartner der weltbekannten Geigerin Anne-Sophie Mutter auf; über elf Jahre lang spielte er zuvor an der Seite des Cellisten Mstislaw Rostropowitsch. Am Donnerstag, 7. Juni 2018, tritt er gemeinsam mit Anne-Sophie Mutter im Konzerthaus Dortmund auf.
Frage: Herr Orkis, Sie sind den letzten Jahren mit bedeutenden Musikern, Orchestern und Ensembles aufgetreten. Haben Sie schon immer das gemeinsame Musizieren einer Solokarriere vorgezogen?
Lambert Orkis: Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich ein wenig ausholen. Aufgewachsen bin ich in einer einfachen Arbeiterfamilie. Mein Vater bekam jeden Monat einhundert Dollar, was nicht viel war. Dennoch unterstütze meine Familie, besonders meine Mutter früh schon mein musikalisches Talent. Diese auch immaterielle Unterstützung war ein großer Ansporn und ich war fest entschlossen, alles zu tun, um erfolgreich zu sein.
Sehr früh bekam ich die Chance, am Curtis Institute of Music zu studieren. Das Konservatorium war zu dieser Zeit eine der wenigen Hochschulen, die keine Gebühr verlangten, sondern im Gegenteil jedem Schüler ein volles Stipendium gewährten. Voll jugendlichen Elans und einer Portion Übermut dachte ich natürlich an eine große Solo-Karriere. Zu dieser Zeit studierte auch der junge David Cole am Curtis Institute. Eines Tages begannen wir einfach zusammen Musik zu spielen, und es war fabelhaft. Zu dieser Zeit realisierte ich das erste Mal, wie wunderbar und natürlich es sich anfühlt, mit anderen Musikern zu spielen, und wie viel man dadurch gewinnen kann. Ich lernte schnell, meinen musikalischen Partnern zuzuhören und auf sie einzugehen.
War das wie ein Geschenk für Sie?
Lambert Orkis: Auf jeden Fall. Viele Leute sahen in der damaligen Zeit keine große Möglichkeit, als Klavierbegleiter erfolgreich zu werden, aber mir war das egal. Mit 19 beendete ich das Studium und wusste nicht gleich weiter. Ich bekam dann das Angebot, als Klavierbegleiter Studenten bei ihren Abschlussprüfungen beizustehen. Im ersten Jahr waren es 47 Prüfungen. Es war eine fast schon verrückte Herausforderung: die unterschiedlichen Ansprüche an die Musik, die verschiedenen Rhythmen und natürlich auch die Vielfalt der Charaktere. Das war keine einfache, aber eine unglaublich gute Schule. Dadurch habe ich gelernt, andere Menschen besser „klingen“ zu lassen.
Eines Tages hörte mich Mstislaw Leopoldowitsch Rostropowitsch. Er kam nach dem Konzert zu mir und umarmte mich. Es fühlte sich an wie die Umarmung eines russischen Bären, warm und ganz flauschig, zugleich aber auch Respekt einflößend. Ich sollte für sein Orchester, das National Symphony Orchestra, spielen und mit ihm Duo-Partnern zur Seite stehen. Das war der Beginn einer wunderbaren Zeit.
Lassen Sie uns trotzdem kurz auf ihre Solo-Einspielungen schauen. Die „Appassionata“ von Ludwig van Beethoven haben Sie auf CD mit drei verschiebenden historischen Flügeln aufgenommen. Wie kam es zu diesem Projekt?
Lambert Orkis: Mit dieser CD bin ich selber auf eine Entdeckungsreise gegangen. Die historische Aufführungspraxis liegt mir sehr am Herzen und ich unterrichte seit vielen Jahren am Boyer College der Temple University in Philadelphia das Klavierspiel auf alten Instrumenten. Ich wollte mir selber bewusst machen, inwieweit der Flügel mit seiner ganz eigenen Mechanik das Klavierspiel, also Tempo, Dynamik, Rhythmik und vieles mehr, beeinflusst. Ich war selber davon überrascht, wie sehr mein Spiel durch die Instrumente beeinflusst wird. Das war eine einmalige Erfahrung!
Auftritt beim Klavier-Festival Ruhr im Dortmunder Konzerthaus
Beim Klavier-Festival Ruhr spielen Sie gemeinsam mit Anne-Sophie Mutter in Dortmund. Seit 1988 treten Sie gemeinsam mit ihr als Klavierpartner in Rezitals auf, also mittlerweile seit 30 Jahren. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit und wie hat sie sich über die Jahre entwickelt?
Lambert Orkis: Ja, wir feiern im Dezember diesen Jahr unser Jubiläum und ich freue mich darauf. Herbert von Karajan schlug Rostropowitsch für sein National Symphony Orchestra damals Anne-Sophie Mutter als Solistin vor. In einer Klavierprobe für das Konzert lernten wir uns kennen und fast schon erschreckenderweise klappte alles auf Anhieb. Nach dem Konzert hörten wir erst einmal nichts voneinander. Eines Tages kam Rostropowitsch auf mich zu und fragte, ob ich mich an Anne-Sophie erinnere. Er erzählte mir, dass sie einen Duo-Partner suche, und ich war sofort Feuer und Flamme.
Es gibt einen kleinen, aber feinen Altersunterschied zwischen uns (lacht). Ich konnte am Beginn unserer Zusammenarbeit meine Erfahrungen mit alter Musik und der historischen Spielweise an sie weitergeben. Ich muss sagen, dass unsere Zusammenarbeit immer angenehm und bereichernd ist. Natürlich sind wir auch nur Menschen und haben gute und schlechte Tage miteinander.
Über die Jahre ist unser Zusammenspiel sehr viel intuitiver geworden. In den Konzerten reichen die kleinsten Gesten, um miteinander zu kommunizieren. Wir ergänzen uns aber auch in den Proben. Ich bin eher der ruhige Typ, sie redet gerne über die Dinge. Es ist eine Art Kommunikation, die es vielleicht sonst nur unter Familienmitgliedern gibt. Ich höre ihr gerne und aufmerksam zu und dann versuchen wir es zusammen. Ganz bescheiden gesagt: Das Ergebnis ist hervorragend.
Sie spielen in Dortmund Johannes Brahms, André Previn, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Krzysztof Penderecki. Ein unkonventionelles Programm, oder?
Lambert Orkis: Seine zweite Klaviersonate hat Penderecki für uns komponiert. Sie ist ein echter Meilenstein in unserer Zusammenarbeit. Das Werk ist komplex in seiner rhythmischen Varianz. Als klassischer Musiker muss man sich erst an die ungewöhnliche Struktur gewöhnen. Seit dem wir das Werk uraufgeführt haben, haben wir sehr hart daran gearbeitet und es auch ein wenig auf eigene Faust variiert.
Bei einem Konzert in Warschau war Penderecki anwesend. Ich kenne ihn schon lange, aber bei diesem Konzert habe ich ihn das erste Mal lächeln sehen. Er war sehr überrascht, aber auch glücklich mit unserer Interpretation. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass unser „klassisches“ Publikum absolut fasziniert ist von diesem erst einmal sperrig wirkenden Werk. Das ganze Programm ist nicht einfach, aber wir brennen für die Musik. Die Menschen erwarten viel in unseren Konzerten. Das spornt uns an und wir versuchen, immer unser Bestes zu geben.
Bleibt ein Duo-Partner eher unbeachtet im Hintergrund?
Oft bekommt man das Gefühl, dass bei Tourneen bekannter Künstler wie Diana Damrau, Jonas Kaufmann oder auch bei Ihnen mit Anne-Sophie Mutter der Duo-Partner eher im Hintergrund steht und nicht wirklich zur Geltung kommt. Wie gehen Sie damit um? Nehmen Sie diesen Umstand überhaupt noch wahr?
Lambert Orkis: Ich habe über viele Jahre jede Kritik zu meinen Konzerten gesammelt. Es müssen mittlerweile mehrere Tausend sein. Beim Lesen der Artikel ist mir dieser Umstand natürlich immer wieder aufgefallen. Aber ich habe auch andere Erfahrungen gemacht. Anne-Sophie und ich gaben ein Konzert in New York. Zu diesem Konzert kamen fünf Kritiker. Jede Kritik zeigte ein anderes Bild. Eine lobte besonders das Spiel von Frau Mutter und ignorierte mich total. Eine andere Kritik schrieb, Frau Mutter könnte sich glücklich schätzen, einen so tollen Partner zu haben, sonst wäre der Abend ein Flop geworden. Ich spiele nicht für den großen Ruhm. Ich spiele für die Musik und liebe meinen Beruf. Die Musik zählt mehr als Aufmerksamkeit und Ruhm.
30 Jahre Klavier-Festival Ruhr, ist das auch für Sie ein Grund zur Freude? Kommen Sie gerne immer wieder ins Ruhrgebiet?
Lambert Orkis: Ich erinnere mich gerne an besondere Momente und die Atmosphäre beim Festival. Ich bin immer wieder beeindruckt vom Publikum. Es ist sehr aufmerksam, emotional und zeigt eine unglaubliche Offenheit für die Musik. Das Festival präsentiert für mich die Kunst des Klavierspiels in allen Facetten der Klassik – nicht nur das große Solo-Repertoire für Pianisten, sondern viel mehr die Entwicklung im Lied, in der Kammermusik und in anderen Gattungen, die das Klavierspiel und die Komposition für das Klavier vorangetrieben haben. Franz Xaver Ohnesorg und seine Partner haben für das Ruhrgebiet eine erstklassige Kulturinstitution geschaffen. Es ist für mich und wahrscheinlich auch für Anne-Sophie eine besondere Ehre, Teil des Festivals zu sein.
Karten für das Konzert am Donnerstag, 7. Juni (20 Uhr im Konzerthaus Dortmund), sind zu Preisen zwischen 35 und 125 Euro erhältlich bei den bekannten Vorverkaufsstellen, über die Tickethotline (01806/500 80 3) oder direkt und platzgenau im Internet unter www.klavierfestival.de