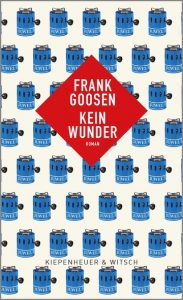Paris zum Ersten, Zweiten und Dritten: Kent Nagano dirigiert das Orchestre Symphonique de Montréal in Essen

Kent Nagano, seit 13 Jahren Chef des Orchestre Symphonique de Montréal, bleibt den Kanadiern noch bis 2020 verbunden. (Foto: Wilfried Hösl)
Bis heute scheint das Orchesterstück „Jeux“ von Claude Debussy überschattet von dem beispiellosen Skandal, den Igor Strawinskys „Le Sacre du Printemps“ auslöste. Nur zwei Wochen lagen zwischen den beiden Uraufführungen im Mai 1913 im Pariser Théâtre des Champs-Élysées. Beide Stücke entstanden für das berühmte Tanzensemble „Ballet Russes“, beide wurden von Pierre Monteux dirigiert, beide gelten auf ihre Weise als Schlüsselwerke der Moderne. Gleichwohl hat Debussys einaktiges Tanzpoem bislang nicht ins gängige Konzertrepertoire hineingefunden.
Ob dies allein am unglücklichen Zeitpunkt der Premiere liegt oder auch am Ballettlibretto von Vaslav Nijinsky, dessen ästhetische Vorlieben weit entfernt waren von den Ansichten und dem Geschmack Debussys, sei dahingestellt. Doch bildeten „Jeux“ und „Sacre“ jetzt die Klammer für ein Konzert in der Philharmonie Essen, das trotz starker Konkurrenz als Höhepunkt der Saison durchgehen kann. Erhellend, ja in höchstem Maße aufschlussreich war die Programmfolge, die das Orchestre Symphonique de Montréal unter seinem langjährigen Chefdirigenten Kent Nagano im Gepäck hatte.
Debussys Partitur, von Komponisten wie Karlheinz Stockhausen und Pierre Boulez ob ihrer Fortschrittlichkeit hoch geschätzt, erfährt dabei eine späte, aber wunderbare Würdigung. Bereits die ersten Takte von „Jeux“ lassen aufhorchen. Es kann kein Zufall sein, dass hier eine archaische Atmosphäre anklingt, die Strawinskys „Sacre“ ungeheuer verwandt wirkt. Die frühlingshaft lichten Holzbläsersoli, die rätselhaft-raffinierten Klänge und Harmonien erscheinen wie eine Vorwegnahme dessen, was zwei Wochen später in die Welt hinaus dröhnen sollte.
Gewiss, es fehlen die schockierenden Schlagzeug-Eruptionen, die dem „Sacre“ rasch zur Unsterblichkeit verhalfen. Aber Kent Nagano und die Musiker aus Montréal machen Debussys Partitur zu einem ungeheuer vielschichtigen Ereignis, das harmonisch und auch seiner Form nach kaum weniger mutig erscheint als das Skandalstück des Exil-Russen.

Der Franzose Jean-Yves Thibaudet spielte das „Ägyptische Konzert“ von Camille Saint-Saëns. (Foto: Decca/Kasskara)
Es folgt eine Sternstunde des Pianisten Jean-Yves Thibaudet, der als einer der profiliertesten Saint-Saëns-Interpreten gilt. Diese Kompetenz kommt dem fünften Klavierkonzert des Franzosen („das Ägyptische“) in höchstem Maße zugute. Thibaudet trumpft mit Fingerfertigkeit und brillanter Virtuosität auf, ohne jemals in den Verdacht zu geraten, sich in bloßem Tongeklingel zu gefallen. Mit großem Feingefühl spürt er dem poetischen Tiefgang dieses farbenreichen Klavierkonzerts nach: seinen schillernden Exotismen, gipfelnd in arabischen Tonleitern und einem nubischen Liebeslied, das Saint-Saëns in Kairo den Schiffern auf dem Nil ablauschte.
Unter Thibaudets Zugriff hält zusammen, was weniger kundigen Interpreten leicht zu zerfallen droht: Passagen von Schubertgleicher Schlichtheit, kraftvolle Ausbrüche à la Rachmaninow, Liszt’sche Campanella-Glöckchen im Diskant. Der Franzose, seit langem eine feste Größe in der internationalen Pianistenszene, stellt sich mit dieser exzellenten Interpretation ein blitzsauberes Zeugnis aus.
Strawinskys Frühlingsopfer („Le Sacre du Printemps“), das im Untertitel „Bilder aus dem heidnischen Russland“ beschwört, lässt mindestens ebenso aufhorchen wie der Beginn dieses erstaunlichen Abends. Denn zunächst hämmert uns keineswegs der harte Sound des anbrechenden Maschinenzeitalters um die Ohren. Die Ostinati klingen vergleichsweise weich, die Klangflächen sind geprägt von französischer Clarté. Das mag zunächst verblüffen, hält den Fokus dieses Abends aber mit äußerster Konsequenz auf Paris. Die Wahlheimat des Exil-Russen drückt dieser Interpretation ihren Stempel auf.
Da Nagano auf erhöhte Podeste für die Bläser verzichtet, mithin alle Musiker auf der gleichen Ebene sitzen, entsteht zwischen den Gruppen eine erstaunliche Balance. Die gestopften Trompeten bringen im zweiten Teil Fernklänge mit purem Gänsehaut-Effekt. Manches Instrument scheint sich beinahe zu verstecken, und doch knüpfen Englischhorn und Bassflöte plötzlich an das ägyptische Kolorit des zuvor gehörten Klavierkonzerts an.
Hartes und Barbarisches muss der „Sacre“-Freund übrigens keineswegs ganz vermissen: Wenn die Pauken simultan losdröhnen, fährt es dem Hörer regelrecht in die Magengrube. Den Tanz des Opfers steigert Nagano bei vollkommener Kontrolle zu einem Hexenkessel, aus dem die Piccoloflöte heraus schrillt. So endet ein grandioser Abend mit einem zutiefst russischen Stück aus dem Geiste französischer Tonkunst.
(Die Reihe „Sinfonische Höhepunkte“ endet am 6. April 2019 mit dem Russian National Orchestra unter Dirigent Alain Altinoglu. Auf dem Programm stehen die „Chowantschina“-Ouvertüre von Modest Mussorgsky und Dmitri Schostakowitschs 5. Sinfonie. Der Pianist Mikhail Pletnev spielt Sergej Rachmaninows 2. Klavierkonzert. Informationen: https://www.theater-essen.de/spielplan/mikhail-pletnevrussian-national-orchestrarac-81418/2531/)