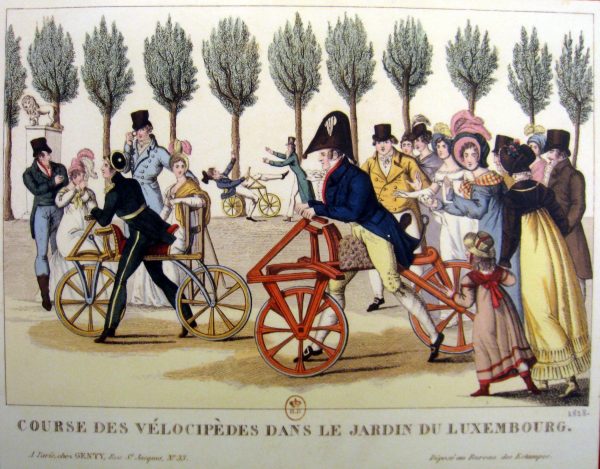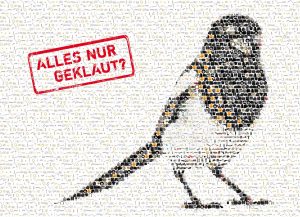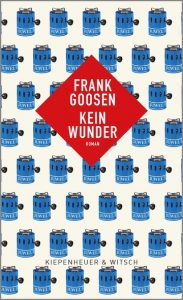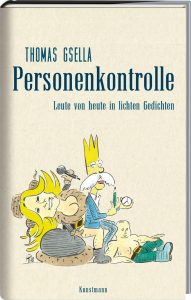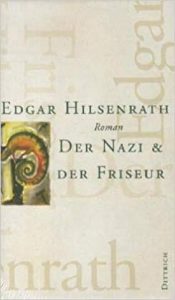Nächste Spielzeit in der Düsseldorfer Tonhalle: Junge Dirigenten, Finale beim Mahler-Zyklus, musikalischer Humor
Das Abo lebt. Davon ist jedenfalls Tonhalle-Intendant Michael Becker überzeugt. Mit einem gründlich renovierten System von Abonnements ist es den Düsseldorfern gelungen, innerhalb von vier Jahren die Zahl ihrer Abo-Kunden mehr als zu verdoppeln und in dieser Spielzeit mit 5.200 noch einmal gut 200 mehr als im letzten Jahr zu gewinnen.
Möglich wird dieser Aufschwung durch flexiblere Angebote: Wer sich für einen Dauerplatz entscheidet, muss nicht zwölf Mal im Jahr ins Konzert gehen, sondern kann sich mit dem Sieben- oder dem Fünf-Sterne-Abo auf die entsprechende Zahl musikalischer Abende beschränken. Auch die Kammermusik – inzwischen regelmäßig im großen Mendelssohn-Saal – und das lockere Format „Ehring geht ins Konzert“ mit dem Kabarettisten gleichen Namens sind im Abo zu buchen.
Christian Ehring übrigens, so wurde angekündigt, nimmt ein Sabbatical und schickt dafür gute Freunde in den Ring: Marco Tschirpke, René Heinersdorff, Martin Zingsheim, Torsten Sträter und Anke Engelke werden die Konzerte moderieren – für Freunde des Genres also eine Gelegenheit, den jeweiligen Musik-Humor der Protagonisten zu genießen.

Bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Programms der Tonhalle und der Düsseldorfer Symphoniker 2019/20 (von links): Uwe Sommer-Sorgente (Dramaturg Tonhalle), Hans-Georg Lohe (Kulturdezernent Landeshauptstadt Düsseldorf), Alexandre Bloch (Dirigent), Michael Becker (Intendant Tonhalle). (Foto: Tonhalle / Susanne Diesner)
Bei allen Erfolgen: Kunst lebt nicht von Zahlen, und so verwies Tonhallen-Dramaturg Uwe Sommer-Sorgente auf einige spannende Linien und Ereignisse der kommenden Spielzeit 2019/20. Das Orchester zeigt sich offen für junge und (noch?) nicht am Jet-Set-Karussell beteiligte Dirigenten.
David Reiland etwa dirigiert beim Konzert mit dem Chor des Städtischen Musikvereins mit Alexander von Zemlinskys 13. Psalm und Robert Schumanns Zweiter Symphonie am 4./6./7. Oktober. Reiland ist Chefdirigent in Metz und Lausanne und regelmäßig an der Opéra in Saint Etienne tätig und hat eine beeindruckende Liste von Assistenzen anzuführen, u.a. bei Pierre Boulez, Dennis Russell Davies, Mariss Jansons, Simon Rattle und Sir Roger Norrington. Sein Interesse an Ungewöhnlichem zeigt sich etwa in einer Aufnahme in Zusammenarbeit mit dem Entdeckungs-Zentrum für die französische Romantik Palazzetto Bru Zane mit sinfonischen Werken von Benjamin Godard.
Aber auch andere Namen stehen auf der Liste: Jesko Sirvend etwa, einst Student in Köln, jetzt am Orchestre National de France und in Düsseldorf kein Unbekannter dirigiert Jean Sibelius‘ Fünfte und zwei Rhapsodien – die berühmte in Blue von George Gershwin und die auf ein Paganini-Thema von Sergej Rachmaninow mit Kirill Gerstein am Flügel (13./15./16. Dezember). Oder Joana Mallwitz, GMD in Nürnberg, eine in letzter Zeit stark beachtete Dirigentin. Sie kommt am 10./12./13. Januar 2020 mit Franz Schuberts „Unvollendeter“ und dem Zweiten Violinkonzert von Dmitri Schostakowitsch mit dem Geiger Vadim Gluzman.
Alpesh Chauhan, der im April 2018 ein „fulminantes“ Deutschland-Debüt bei den Düsseldorfer Symphonikern gegeben hatte, kehrt zurück und dirigiert Antonín Dvořáks Siebte und das Cellokonzert. Chauhan, Chefdirigent der Filarmonica Arturo Toscanini im italienischen Parma, ist selbst Cellist – so dürfte die Zusammenarbeit mit dem Solisten Pablo Ferrández ein spannendes Ergebnis zeitigen (31. Januar/2./3. Februar 2020). Chauhan leitet auch das Neujahrskonzert der Düsseldorfer Symphoniker am 1. Januar 2020.

Adam Fischer. (Foto: Tonhalle / Susanne Diesner)
Seinem Abschluss strebt der Haydn-Mahler-Zyklus mit Adam Fischer entgegen: Am Ende steht Haydns Hommage an die Offenbarung Gottes in der Natur. „Die Jahreszeiten“ erklingen am 15./17./18. Mai 2020. Mit der Sechsten wird am 28. Februar und 1./2. März 2020 die Serie der Mahler-Symphonien abgeschlossen; dazu gesellt sich Haydns Nr. 49.
Eine Rarität präsentiert Axel Kober am 24./26./27. April gemeinsam mit Felix Mendelssohn Bartholdys „Schottischer“ Symphonie und Brittens „Sea Interludes“: ein Konzert für zwei Harfen des 1808 in Devonshire/England geborenen Harfenvirtuosen Elias Parish Alvars. Der bereits 1849 in Wien gestorbene Alvars war Kaiserlicher Kammervirtuose und Solist an der Wiener Hofoper und genoss in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts einen internationalen Ruf als Harfenist, der die moderne Spieltechnik auf dem Instrument mit entwickelte.
Auch ein Blick auf die Kammermusik lohnt: Zur Eröffnung der „Raumstation“-Reihe treffen sich am 30. Oktober so glanzvolle Solisten wie Bertrand Chamayou (Klavier), Daniel Müller-Schott (Cello) und Sabine Meyer (Klarinette) und spielen Beethoven und das d-Moll-Trio Alexander von Zemlinskys. Am 2. Dezember musizieren Elisabeth Leonskaja und das Jerusalem Quartet Werke von Mozart, Dvořák und die Fünf Stücken für Streichquartett von Erwin Schulhoff. Seltenes aus der Feder des Jahresjubilars Ludwig van Beethoven spielen am 4. Februar 2020 „Les Vents Français“, ein Quintett mit so klingenden Namen wie Francois Leleux (Oboe), Paul Meyer (Klarinette), Gilbert Audin (Fagott) Radovan Vlatković (Horn) und Eric Le Sage (Klavier).
Eine „Sternstunde“ will das Bach Collegium Japan bereiten, das am 14. März 2020 die Johannes-Passion des Thomaskantors aufführen wird. Und unter dem Titel „X-Mas Contemporary“ haben sich der Bariton Dietrich Henschel und das ensemble unitedberlin etwas Originelles einfallen lassen: Zwölf Komponistinnen und Komponisten aus unterschiedlichen kulturellen und religiösen Traditionen haben Weihnachtsstücke geschrieben, die am 17. Dezember erklingen.
Infos auf der Seite www.tonhalle.de unter den Reitern Reihen und Abos.