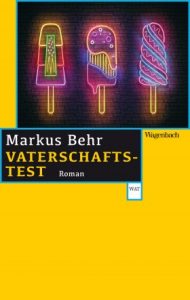Der Struwwelpeter, der Suppenkasper und ihre Wirkung auf die Kunst – eine Ausstellung in Oberhausen
„Sieh einmal, hier steht er, pfui! der Struwwelpeter!“ – Diese irrwitzig lang abstehenden Haare und dito Fingernägel. Rings um seine bizarre Gestalt ist es auch nicht ordentlicher bestellt: die permanente Suppen-Verweigerung, das unentwegte Daumenlutschen. Weit schlimmer noch: die leuchtend roten Schuhe, die von Paulinchen nach ihrem Zündel-Inferno als einzige Relikte übrig bleiben. Die beiden Katzen, die sie vor dem Feuer gewarnt haben und nun Sturzbäche von Tränen vergießen. Der unverwechselbare Riesenschritt, mit dem Han(n)s Guck-in-die-Luft in sein Verderben stürzt…
Diese und viele andere Bilder aus Heinrich Hoffmanns „Struwwelpeter“ gehören seit etlichen Generationen zum kollektiven Gedächtnis und haben höchsten Wiedererkennungswert. Sie blitzen immer mal wieder auf und reizen häufig zum Fortspinnen der alten Geschichten. Oder zum Widerspruch. Also sind sie immer wieder aufgegriffen, variiert, parodiert, paraphrasiert oder auch konterkariert worden.
Damit und natürlich mit dem nachwirkenden Original befasst sich jetzt anhand von weit über 200 Exponaten die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen. Ausstellungs-Kuratorin Linda Schmitz spricht von lauter „Struwwelpetriaden“. Gar manche stammen vom spezialisierten Sammlerpaar Nadine und Walter Sauer.
Das weltweit berühmteste deutsche Kinderbuch
„Der Struwwelpeter“ ist schlichtweg das berühmteste aller deutschen Kinderbücher, das weltweit in zahllosen Ausgaben erschienen ist. In Oberhausen finden sich etliche Exemplare als Belege, die erschröcklichen Geschichten sind in fast allen denkbaren Welt- und Regionalsprachen zu lesen, vom Chinesischen bis zum Ruhrdeutschen. Auch ein Mark Twain hat zum breiten Strom der globalen Rezeption eine Übersetzung ins Englische beigesteuert.
In Oberhausen lassen sich die verschiedenen Fassungen seit dem Urmanuskript von 1844 (heuer ist’s 175 Jahre her) miteinander vergleichen. Tatsächlich unterscheiden sie sich deutlich. Erst nach und nach sind die Bilder so entstanden, wie wir sie kennen. Die Aussagen verdichten sich zusehends, Gestalten und Abläufe werden immer prägnanter und kraftvoller ausgeführt, neue Figuren kommen hinzu.
Damit man sich einen Begriff von der raschen Verbreitung machen kann: Ende 1859 erschien bereits die 27. „Struwwelpeter“-Auflage. Übrigens sind die frühen Blätter in der Ludwiggalerie nur als – sorgsam erstellte – Faksimiles zu sehen, die Originale (besonders im Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg) sind so empfindlich, dass sie nicht ausgeliehen werden dürfen.
Drastische Konsequenzen des Tuns
Der Frankfurter Hoffmann, im Brotberuf Arzt und als zeichnender Dichter ein begabter Laie, hat die bis dahin üblichen Kinderbücher nicht gemocht. Was sollten die ewigen belehrenden Abbildungen aus der Dingwelt? Ein Stuhl, eine Jacke, ein Apfel… War es nicht besser, wenn die Kinder statt dessen sinnlich die fassbare Wirklichkeit entdeckten? Und was half es, die Kleinen unentwegt zum Bravsein anzuhalten? War es nicht weitaus wirksamer, ihnen in aller Drastik die Konsequenzen von Handlungen zu zeigen, die als vernunftlose Missetaten gewertet wurden? Also erfand Hoffmann beispielsweise den anfangs kerngesunden Suppen-Kasper, der nun freilich Tag um Tag trotzig die Nahrungsaufnahme verweigert („Nein, meine Suppe ess‘ ich nicht“) und immer mehr zum kläglichen Gerippe abmagert. Gruselige Schlusszeilen: „Er wog vielleicht ein halbes Lot – / Und war am fünften Tage tot.“

Friedrich Karl Waechter: Bild aus dem „Anti-Struwwelpeter“ (Geschichte vom Suppen-Kasper), 1970. (© Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst, Hannover)
Sodann der denkbar vielfältige Umgang späterer Künstler mit der Vorlage. Hans Witte hat nur typographische Aspekte herausgegriffen, hat einzelne Worte und Buchstaben aus dem „Struwwelpeter“ umgestaltet. Im antiautoritären Geist der Achtundsechziger hat hingegen F. K. Waechter in seinem ebenfalls schon legendären „Anti-Struwwelpeter“ (1970) die seinerzeit als Schwarze Pädagogik verschrienen Ansichten Hoffmanns gegen den Strich gebürstet.
Frühe Kritik am Rassismus
Heute geht man nicht mehr gar so hart mit dem angeblichen „Kinderschreck“ Hoffmann ins Gericht. Pädagogisch waren seine Einfälle und der beherzte Themenzugriff teilweise gar nicht so verkehrt. Zudem: Mit seiner ärztlichen Haltung, psychische Krankheiten als nicht selbstverschuldet und als heilbar aufzufassen, stand er zu seiner Zeit an der Spitze des Fortschritts. Und seine mahnende Geschichte über weiße Rabaukenknaben, die sich über einen „Mohren“ lustig machen, kann als antirassistisches Musterstück gelten.
Doch weiter mit den Nachfolgern: In einer Bilderserie von Matthias Kringe wird der „Struwwelpeter“ kreativ mit Star Wars überblendet. Plötzlich taucht mittendrin Darth Vader auf. Andere, wie etwa Manfred Bofinger, erzählen im Gefolge Hoffmanns von gewaltsamen Umtrieben der Neonazis. Schon in den 1940er Jahren gab es einige Hitler-Parodien in Struwwelpeter-Optik, allen voran der britische „Struwwelhitler“ („A Nazi Story Book by Doktor Schrecklichkeit“) von 1941.
Die Künstlerin Angela Bugdahl hat einzelne Momente aus Hoffmanns Geschichten herausgegriffen und stellt etwa das Daumenlutschen als durchaus natürlichen Vorgang dar, der eben nicht unterdrückt werden sollte. Den Suppen-Kasper lässt sie unterdessen mit den Mitteln der Pop Art wieder aufleben. Ein Junge mag nicht die durch Andy Warhol kunstberühmt gewordene Campbell’s-Dosensuppe essen. Vielleicht hat er ja seine nachvollziehbaren Gründe?
Eine hoffnungslose Welt
David Füleki treibt derweil die „schwarzen“ Geschichten Hoffmanns auf die Spitze, indem er auf entschieden anarchistische Weise die Dystopie einer hoffnungslosen Welt mit grundsätzlich verzweifelten Kindern entwirft.
Eben daran erkennt man wahre Klassiker: Sie sind sozusagen universell „anschließbar“, letztlich auch für einen Hersteller, der mit „Struwwelpeter“-Shampoo auf den Markt kam. Für die Musik, in der der Struwwelpeter gleichfalls Spuren hinterließ, bleiben angesichts so vieler Verzweigungen nur ein paar Seitenblicke.
Anno 2018 kommt der kaum vermeidliche Jan Böhmermann bildlich auf den Struwwelpeter zurück, um auf seine erhellend irrlichternde Weise etwa von Eltern im heutigen Bionade-Biedermeier zu erzählen. Auch diesen Film kann man in der Ausstellung sehen.
„Ruhestörung“ in der Biedermeier-Zeit
Apropos: Hoffmanns „Struwwelpeter“ gehört ursprünglich in den Kontext des Biedermeier um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein in Oberhausen gezeigtes Original-Zimmer aus jener Zeit steht für den betulichen Rückzug ins (klein)bürgerliche Dasein, man könnte auch sagen: in verlogene Gemütlichkeit fernab aller politischen Zumutungen. In solcher Zeit dürften „Struwwelpeter“ und Konsorten als „Ruhestörer“ Furore gemacht haben.

ATAK/Prof. Georg Barber: „Der Struwwelpeter, Konrad und Schneider“, 2009 (© ATAK und Kein & Aber Verlag, Zürich, 2009)
Zur Genese des „Struwwelpeter“ befragt, hat Heinrich Hoffmann in der Zeitschrift „Gartenlaube“ geschrieben, er habe die Geschichten für seinen damals dreijährigen Sohn gereimt und gezeichnet, weil nirgendwo sonst etwas Passendes im Angebot gewesen sei. Mag sein, dass der einfallsreiche Mann damit auch an der eigenen Legende stricken wollte.
„DER STRUWWELPETER. Zappel-Philipp, Paulinchen und Hanns Guck-in-die-Luft. Zwischen Faszination und Kinderschreck von Hoffmann bis Böhmermann“. 22. September 2019 bis 12. Januar 2020. Geöffnet Di-So 11-18 Uhr. Eintritt 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Katalog 29,80 Euro. Weitere Infos: www.ludwiggalerie.de
_________________________________
Vom 29. September 2019 bis zum 19. Januar 2020 ist im Kleinen Schloss der Ludwiggalerie zusätzlich die Ausstellung „Simon Schwartz – Geschichtsbilder. Comics & Graphic Novels“ zu sehen. Gleiche Öffnungszeiten wie beim Struwwelpeter, aber Eintritt frei.