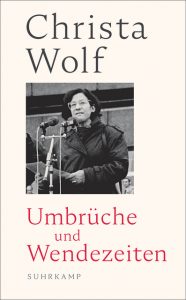Vor Möhringer sei gewarnt: Wilhelm Killmayers „Yolimba“ klärt am Theater Münster auf, was es mit dem Manne auf sich hat
Alle großen Momente sind von einer gewissen Magie umweht, seien es Wendemarken des eigenen Daseins oder entscheidende Weichenstellungen der Geschichte.

Gregor Dalal (Mitte) steuert als Magier Möhringer seine Höllenmaschine. Foto: Oliver Berg
Das magische Charisma von Alexander dem Großen etwa beschäftigte zahllose Schülergenerationen altsprachlicher Gymnasien; die Verwandlungskunst der Zauberin Circe faszinierte Leser von Homers Epen über Tausende von Jahren hinweg. Selbst Einsteins geniale Formel hat in der Wissenschaft eine unbestimmbare Ausstrahlung, wie sie in der Musik die magische Hand Herbert von Karajans auszulösen vermochte. Und auch bei Möhringer ist die Magie unschwer zu entdecken.
Wie, verehrtes Publikum, Sie wissen nicht, wer Möhringer ist? Verständlich. Auch Professor Wallerstein, ein nicht unbedeutender Archäologie, kannte den Namen nicht, nahm aber von der Post fatalerweise eine Kiste mit diesem Absender in Empfang. Sein Verhängnis! Wenige Minuten später war er tot.
Das Wörtchen „Liebe“ bringt den Tod
Sie, hochgeschätzter Theaterbesucher, haben also möglicherweise viel Glück gehabt. Denn Möhringer ist ein veritabler Magier und Schöpfer eines Wesens, dem Sie besser nicht begegnen, sollten Sie jemals das Wort „Liebe“ auf den Lippen tragen: Nach eigenen Worten ein „Mann der Ordnung“, hat Möhringer dieses Geschöpf des Lasters und der Magie wie ein Doktor Frankenstein in einer Höllenmaschine geschaffen. Ein Mädchen mit grellroten Haaren, aus einem Rohr ausgespuckt auf die Erde. Die Lady erschießt jeden, der es wagt, „Liebe“ zu sagen. Denn die Liebe soll um der Ordnung willen ausgerottet werden, und mit ihr das „Laster“. Der Archäologe und brave Familienvater war der erste Delinquent.

Auch die Polizei ist im Falle Yolimbas machtlos: Stefan Sevenich, Pascal Herington, Marielle Murphy, Youn-Seong Shim. Foto: Oliver Berg.
Die eiskalte Mörderin namens Yolimba treibt derzeit auf der Bühne des Theaters in Münster sein Unwesen. Ihr wirklicher Schöpfer ist natürlich nicht „Möhringer“. Der ist, wie Yolimba selbst, ein Produkt der literarischen Fantasie von Tankred Dorst, der diese wiederum dem Komponisten Wilhelm Killmayer anvertraut hat. Und Killmayer, in den fünfziger bis neunziger Jahren ein erfrischend wider den Stachel der musical correctness löckender Tonsetzer, hat aus dem Büchel eine wunderfeine Posse verfertigt, in bester Tradition zwischen Jacques Offenbach, Goldene-Zwanziger-Varieté und Schlagerseligkeit der Nachkriegszeit. Ein absurdes Spiel, dessen Amüsierwert seit der Uraufführung 1964 und einer Neufassung 1970 nicht verblasst ist.
Dass die lustvolle, kurz wie kurzweilig daherkommende Posse so gut wie nie nachgespielt wurde, ist verwunderlich: Sie unterhält prächtig, ist auf herrlich manierierte Weise absurd, und vor allem gesegnet mit feinsinniger Musik.
Killmayer bedient sich aus allen möglichen Traditionen. Der Eröffnungschor „Wie schön ist der Mai“ mimt kunstvoll die musikalische Schlichtheit eines Fünfziger-Jahre-Trällerschlagers. Solisten wie die drei an die „Zeitdiebe“ aus „Momo“ erinnernde Herren (Youn-Seong Shim, Pascal Herington, Stefan Sevenich) singen a cappella, als kämen sie aus einem Madrigal oder einer Nummer der Comedian Harmonists. Kontrapunkt und Harmonielehre werden auf gelehrte Weise vorgeführt. Barocke Ritornelle wechseln mit lautmalerischen Momenten ab und über allem schweben mühelos wirkende, melodisch pikante Gesangsstimmen. Das Triviale mündet ins Absurde, das Groteske mimt ganz ernst den Alltag.
Humor und Groteskerie ohne aufgesetzten Überbau

Auch die Polizei ist im Falle Yolimbas machtlos: Stefan Sevenich, Pascal Herington, Marielle Murphy, Youn-Seong Shim. Foto: Oliver Berg.
Yolimba also, unschwer als Ableitung aus dem Namen „Olympia“, der Puppe in Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ erkennbar, feuert vor ihren Pistolenkugeln erst einmal Staccati, Acuti, Melismen und Vokalisen ab: Marielle Murphy entledigt sich ihrer Tonsalven rasant und so aufgedreht, dass sie sich gleich die Lacher des Publikums einfängt. Regisseur Ulrich Peters, der Münsteraner Intendant, hat für solche Figuren und Situationen ein unfehlbares Händchen – er ist einer der wenigen, der die Zwischentöne des Humors und der Groteskerie ohne aufgesetzten Überbau, aber mit zündender Intelligenz auf die Bühne bringen kann.
An eine Offenbach-Figur, nämlich Spalanzani, erinnert auch der ominöse Möhringer: Gregor Dalal grundiert ihn dank mächtiger, satt artikulierter Basstöne mit einem dämonischen Zug, doch das altertümliche Kostüm (wie die Bühne von Andreas Becker), die hochgebundene Frisur und der prätentiös kunstvolle Bart lassen ihn als wunderliche Gestalt zwischen komischem Alten und Steampunk-Freak erscheinen.
Nächstes Opfer Yolimbas ist ein Operntenor, der so aussieht, wie sich die Werktreuen-Fraktion einen solchen vorstellt. Zu seinem Unglück macht Juan S. Hurtado Ramirez den naheliegenden Fehler, klangvoll „amore“ in den Raum zu schleudern. Es gibt noch eine Reihe weiterer Opfer, bis der Plakatankleber Herbert (Pascal Herington hat die Musik für den kranken Stephan Boving in einer Nacht einstudiert, Max Hülshoff spielt ihn auf der Bühne), den Bann der Magie bricht, weil er zu schüchtern ist, das tödliche Wörtchen auszusprechen. Yolimba verliebt sich; für den Magier wird ein Abfallcontainer zur Falle: In der Zerkleinerungsmaschine der in einem kunstvoll komponierten Lobeschor gepriesenen Müllabfuhr verpufft sein Dasein und lässt nur noch schwärzliche Fetzen seiner magischen Macht herabregnen. Der Schluss besingt erneut den schönen Mai, während die Opfer auferstehen wie die Lebkuchenkinder in Humperdincks „Hänsel und Gretel“.
Die quirligen achtzig Minuten vergehen wie im Flug. Killmayer versteckt elaborierte Kunst hinter einem sprühenden Feuerwerk musikalischer Eingängigkeiten, die Thorsten Schmid-Kapfenburg mit einer bunt gemischten Truppe mit stets leichter Hand so durchsichtig, pointiert und mit Esprit gesegnet wie eben möglich präsentiert.
Den Kinderchor und die jugendlichen Sängerinnen und Sänger der Westfälischen Schule für Musik, die mit diesem Kooperationsprojekt ihr 100jähriges Bestehen feiert, hat Claudia Runde schlicht entzückend präpariert; die Choreografie Kerstin Rieds funktioniert, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.
Das Sinfonieorchester Münster stellt die üppige Besetzung im Graben nicht alleine; es wirken Studenten der Musikhochschule Münster mit, die es in solistischen Passagen und in der heiklen Balance filigran komponierter Momente nicht an Können fehlen lassen. Rundum vergnüglich, diese „Yolimba“, und wieder einmal ein Tipp für Theater, an denen Witz und heit’re Laune noch ein Heimatrecht genießen.
Nächste Vorstellungen am 8. und 24. Januar 2020. Tickets: Tel.: (0251) 59 09-100, www.theater-muenster.com