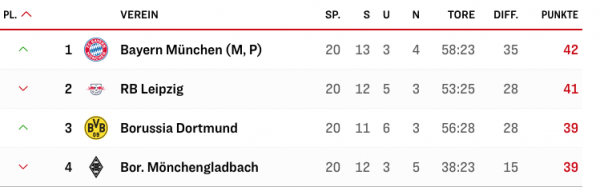Kuratorin Nicole Grothe erläutert ein Hauptstück der Sammlung: August Mackes Bild „Großer zoologischer Garten“. (Foto: Bernd Berke)
Ohne englische Titel geht praktisch nichts mehr im Museum Ostwall. Kürzlich eröffnete hier mit „The Other Side“ eine Schau zu neueren Positionen irischer Kunst. Und nun erhält die Präsentation der eigenen Sammlung wieder einen neuen Schub. Titel: „Body & Soul“. Im Dortmunder U, wo die Ostwall-Sammlung sich seit nunmehr 10 Jahren befindet, gibt man sich eben gern weltläufig und popkulturell anschlussfähig.
Aber Moment mal! Hatten wir nicht erst gegen Ende 2017 die Premiere eines ziemlich gründlich umgeschichteten Eigenbesitzes? Richtig. Seinerzeit hießt das Resultat „Fast wie im echten Leben“ und wurde an dieser Stelle gleichfalls gewürdigt. Damals kündigte der inzwischen nach Maastricht gewechselte Direktor Edwin Jacobs an, die Sammlung solle nachhaltig „dynamisiert“ werden. Auch die ersten Anstöße zur jetzigen Ausstellung stammen noch von ihm.
Beim Alltag des Publikums anknüpfen
Abermals werden nun bedeutsame Teile der Kollektion nicht etwa in kunstgeschichtlicher Abfolge, sondern in Form einer Themenausstellung gezeigt, die just Leib und Seele in den Blick nimmt und – so die Leitlinie – möglichst in den Lebenswelten und bei den Alltagserfahrungen des geneigten Publikums anknüpfen soll. Einen Körper und eine Seele haben wir halt alle. Mit solch daseinsnahen Ansätzen will man auch Leute ins Museum holen, die bisher nur selten mit Kunst in Kontakt gekommen sind.
Aus einem Fundus von rund 7500 Arbeiten im Besitz des Ostwall-Museums lässt sich ein derart umfassendes Doppelthema wie Leib und Seele natürlich allemal vielfach vergegenwärtigen. Rund 130 Werke hat die Sammlungsleiterin und Kuratorin Dr. Nicole Grothe mit ihrem Team ausgewählt. Die Präsentation meidet nach Kräften Beliebigkeiten, sie wirkt auch nirgendwo überfüllt oder beengt. Die Kunst hat genügend Platz zum „Atmen“ und Wirken.
Nacktheit, Kleidung, Bewegung, Ernährung, Schlaf und Tod
Der thematische Rundgang beginnt quasi elementar, nämlich mit nackten Körpern, also Aktdarstellungen. In diesen Kontext gehört auch eine „Ikone“ wie Otto Muellers „Drei Badende im Teich“, wie denn überhaupt deutlich wird, dass ein gehöriger Schwerpunkt der Sammlung dem Expressionismus und seinem Umfeld zuzurechnen ist. Damit eröffnet sich, nebenbei sei’s gesagt, eine wunderbare Möglichkeit zum Vergleich mit der Sammlung des Hagener Osthaus-Museums, das derzeit seine nach über vierjähriger Tournee heimgekehrten expressionistischen Schätze zeigt. Dazu demnächst ein paar Zeilen mehr.

Pablo Picasso (1881-1973): „Femme nue couchée“ (Schlafende Nackte), Öl auf Leinwand, 1965 (Bild © VG Bild-Kunst, Bonn 2020 / Foto © Jürgen Spiler)
Doch zurück nach Dortmund: Auch die Relativität von Schönheitsidealen soll sich anhand mancher Körperbilder und Skulpturen zeigen (etwa mit einer rundlich-drallen Frauenfigur oder männlichen Bauchformen als Wandinstallation), ebenso wie die nicht zuletzt durch Kleidung markierte Zuschreibung von Geschlechter-Identitäten, welche – auch unserem waltenden Zeitgeist gemäß – als fließend zu denken sind.
Das Paradies und die Zivilisation
Apropos Kleidung. Ein immer wieder und immer wieder anders hervorgehobenes Hauptstück der Sammlung, August Mackes „Großer zoologischer Garten“, offenbart in diesem Zusammenhang eine zusätzliche Lesart. Bisher galt das Bild meist als Vergegenwärtigung des paradiesischen Gartens Eden, die Zoobesucher tragen jedoch betont modische, zeitgenössische Kleidung, so dass man sie wohl zur gehobenen Gesellschaft rechnen muss. Es geht also nicht nur um Natur, sondern mindestens ebenso sehr um Zivilisation bzw. um das Verhältnis beider Wesenheiten zueinander.
In insgesamt neun Kapiteln kann man etliche Erkenntnisse gewinnen oder zumindest Aha-Momente erleben, so etwa auch zur Beschaffenheit sportlicher und tänzerischer Körper, wobei z. B. Radierungen von Karl Hofer direkt neben Barbara Hlalis Zeichnungen von DJs zu sehen sind. Die Lust an der Bewegung höret demnach quer durch die Generationen nimmer auf; es sei denn: im Tod, der in einer künstlerischen Körper-Ansammlung natürlich nicht übergangen werden kann und auch in Bildern des Schlafes gegenwärtig ist. Dass Sterben und Schlafen miteinander verquickt und verschwistert, ja mitunter kaum unterscheidbar sind, lässt Dieter Kriegs „Weiße liegende Figur“ ahnen.

Thomas Bayrle (*1937): „Super Colgate“, 1965. Holz, Metall, Elektromotor, Ölfarbe – Erworben aus der Sammlung Feelisch (Bild © VG Bild-Kunst, Bonn 2020 / Foto: © Jürgen Spiler)
Was es mit dem Zähneputzen auf sich hat
Auch Aspekte der Ernährung und Körperpflege kommen künstlerisch zum Vorschein, das Spektrum reicht von Willi Repkes konventionell anmutender „Marktfrau“ bis zu Thomas Bayrles Installation „Super Colgate“, die eine Zahncreme-Werbung der 1960er Jahre parodistisch aufgreift. Die lustige oder eben auch putzige Kunst-Maschine sorgt auf Fußschalter-Druck dafür, dass ganz viele Figürchen sich gleichzeitig die Zähne putzen. Daraus leitet sich auch der Untertitel der gesamten „Body & Soul“-Unternehmung her, welcher da lautet: „Denken, Fühlen, Zähneputzen“. Warum nicht auch mal ein bisschen albern sein?

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938): „Stafelalp bei Mondschein“, 1919, Öl auf Leinwand (Foto © Jürgen Spiler)
Das Seelenleben wird sodann unter anderem am Beispiel von Naturempfindungen erkundet, so mit Ernst Ludwig Kirchners „Stafelalp bei Mondschein“ oder einem mit Angst befrachteten, surrealen Waldbild von Max Ernst („Forêt aux champignons“). Überhaupt ist den Ängsten, den Verletzungen und der Trauer ein weiteres Kapitel gewidmet, das sich existenziell durch die Jahrzehnte zieht. Hier wird vermutlich jede(r) dem persönlichen Dämon begegnen können, sei er nun von Norbert Tadeusz, Ina Barfuss oder anderen Visionären der Kunst imaginiert worden.
Nach eigenen Erinnerungen graben
Die eigenen Erinnerungen entdecken soll man nach dem Willen des Aktionskünstlers Wolf Vostell mit seinem (hier von Gregor Jabs re-inszenierten) Happening „Umgraben“ (1970), dessen Szenarium sich hinter einem Vorhang erstreckt. Das Grabefeld soll man nicht mit eigenen Schuhen, sondern mit bereitgestellten Gummistiefeln betreten – und dann mit dem Umgraben loslegen. Mag schon sein, dass sich dabei ein meditativer Sinn einstellt. Übrigens ist Vostells Arbeit diesmal eines der wenigen Beispiele aus dem Bereich der so genannten Fluxus-Kunst, die ja eigentlich einen weiteren Schwerpunkt der Sammlung ausmacht.

Wolf Vostell (1932-1998): „Umgraben“, Happening von 1970, Re-Inszenierung von Gregor Jabs, 2012 (Bild © VG Bild-Kunst, Bonn 2020 / Foto © Jürgen Spiler)
Mönchsfigur mit Münzeinwurf
Nicht nur explizit religiöse Glaubensfragen sind ein weiteres Feld der hiesigen Seelenkunde. Dabei fällt auch eine Dortmunder Neuerwerbung auf, nämlich Michael Landys Mönchsfigur mit „Donation Box“ (Spendenbox), in die man echte Münzen einwerfen kann. Wofür die etwaigen Einnahmen der Ablasszahlungen verwendet werden (geringfügige Aufstockung des Museumsbudgets?), ist derweil noch nicht ausgemacht.
Und die Schlussakkorde? Sind wiederum betont sanftmütig und tröstlich, denn es werden Werke zum Thema Liebe, Zuneigung, Freundschaft und Fürsorge versammelt. All das, was den Menschen guttut. Auf dass man das Museum heiteren Sinnes verlasse.
Zur anders gewichteten Kunst kommt die neue „Inszenierung“: In Zusammenarbeit mit dem niederländischen Designbüro SODA (Ronald Buiel und Jorrit Noyons aus Arnheim) hat man neue farbliche und architektonische Akzente gesetzt. Wir würden uns ja den Kalauer schenken, die Kunstwerke seien nach den Interventionen von SODA nun einfach so da. Aber jetzt ist er nun einmal heraus und geht auch nicht ganz fehl.

Viel Freiraum für die Kunst: Blick in die neue Sammlungs-Präsentation. Die Figur in der Mitte ist übrigens nicht echt, sondern künstlich, Verzeihung: künstlerisch. (Foto: Bernd Berke)
Orientierung durch neue Farbakzente
Tatsache ist jedenfalls: Die schon auf den Fluren der 4. und 5. Etage dominierende Lachsfarbe soll die Orientierung im riesigen Haus erleichtern. Vordem hatten sich nicht wenige Besucher über labyrinthische Verwirrung beklagt. Mal sehen, ob diese Irritation nun nachlässt. Außerdem verändert: Reflektierende Flächen, die den Blick ablenken konnten, sind weitgehend verschwunden. Architektonische Charakteristika, wie etwa das Deckenraster im Dortmunder U, kommen besser zur Geltung.
Wohlfühl- und Willkommens-Faktor
Überdies wurden auch die alten (vormals dunklen) Sitzbänke hell gestrichen und alle abweisenden Kanten einladend abgerundet. Überhaupt haben die Museumsleute versucht, einen durchgehenden Wohlfühl- und Willkommens-Faktor zu erzeugen. Das reicht von helleren und wärmeren Farben über eine möglichst stets besetzte und auskunftsbereite „Rezeption“ am Eingang bis zu einer kuscheligen Landschaft mit Kissen und Sitzsäcken. Chillen ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Auch das geht mit dem Zeitgeist konform.
Aber nun mal ganz ehrlich: Das Farbkonzept mit den verschieden abgemischten Lachstönen hat mich an die etwas weichgespülte Corporate Identity einer schwedischen Bank erinnert, die vor allem auf sanftes Rosa zurückgreift und ihre Bezahlvorgänge als „smooth“ (glatt, seidenweich, problemlos) bezeichnet. Egal. Jedem seine Assoziationen. Und es heißt gewiss nicht, dass die Bilder nicht zur Geltung kämen.
Alle zwei Jahre werden die Werke neu gemischt
Sammlungsleiterin Nicole Grothe möchte den Eigenbesitz auch künftig ungefähr im Zweijahresrhythmus immer wieder neu arrangieren, ihn gleichsam regelmäßig durchlüften und damit wechselnde Zusammenhänge stiften. Relativ kostengünstig sind derlei Schauen aus dem Bestand allemal, es werden keine Leihgebühren fällig, zudem riskiert man keine Transportschäden und muss daher auch keine horrenden Versicherungssummen zahlen.
Doch selbstverständlich hat der Umbau, der sich einige Monate hingezogen hat, ein paar Scheinchen gekostet, genauer: 422.000 Euro. Der Rat der Stadt hatte zu dem Zweck 500.000 Euro gebilligt, der Etat wurde also unterschritten. Es könnte ein gutes Omen sein.
„Body & Soul. Denken, Fühlen, Zähneputzen“. Neue Sammlungspräsentation des Museums Ostwall im Dortmunder U (4. und 5. Ebene), Leonie-Reygers-Terrasse (Navigation: Brinkhoffstraße 4 / Parkhaus).
Update: Ausstellung wird bis November 2022 verlängert
Ursprünglich vom 8. Februar 2020 bis 27. Februar 2022 (verlängert bis zum 13. November 2022).
Geöffnet Di/Mi/Sa/So/Feiertage 11-18 Uhr, Do/Fr 11-20 Uhr.
Tel.: 0231/50 247 23. Mail: info@dortmunder-u.de
Kunstvermittlung/Führungen: 0231/50-277 86 oder 50-277 91.
www.museumostwall.dortmund.de