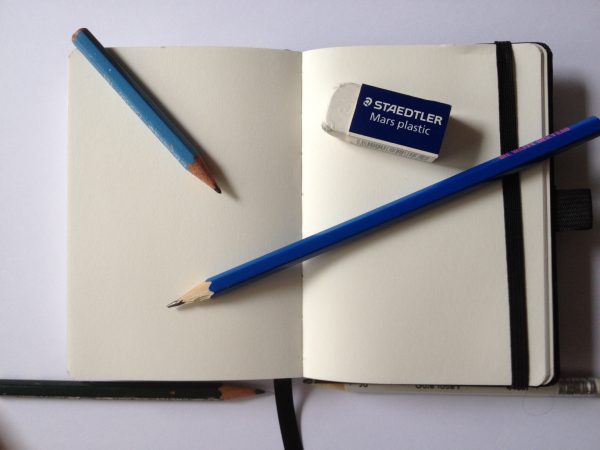Die Kraft der Musik ist zurück: Rudolf Buchbinder beim Klavier-Festival Ruhr in Bochum – unter teils surrealen Umständen

Sehr spezieller Moment nach Rudolf Buchbinders Konzertauftritt: Die Blumen-Übergabe erfolgte diesmal per Roboter. Die Apparatur ist eine Entwicklung des Lehrstuhls für Produktionssysteme im Fachbereich Maschinenbau der Ruhr-Uni Bochum (Prof. Bernd Kuhlenkötter). (Foto: Sven Lorenz)
Gastautor Robert Unger über den Wiederbeginn des Klavier-Festivals Ruhr – unter teilweise surreal anmutenden Bedingungen:
„Endlich sind Sie wieder da!“, begrüßte der Intendant des Klavierfestivals Ruhr, Franz Xaver Ohnesorg, die Konzertbesucher. Voller Spannung wartete das Publikum auf dieses Live-Erlebnis.
Betritt man das Anneliese Brost Musikforum Ruhr in Bochum für das erste Konzert des Festivals in seiner nun arg verkürzten Spielzeit, fühlt man sich eher wie in einer Quarantänestation. Mit großem Abstand und unter strengen Hygieneregeln verteilen sich im 952 Plätze fassenden Konzerthaus knapp 200 Besucher. Das Foyer, bei den meist ausverkauften Konzerten im Musikforum sonst stets ein proppenvoller, summender Bienenstock, ist an diesem Tag sehr übersichtlich belegt. Hier und da stehen zwei, drei, vier Musikfreunde mit Abstand beisammen, plaudern, begrüßen sich. Dabei ist gerade in schwierigen Zeiten eigentlich das Bedürfnis groß, lebendige Konzertmomente zu erleben. So war das Publikum voller Spannung; eine Reihe von Besuchern ließ auch die Dankbarkeit dem Klavier-Festival Ruhr gegenüber spüren, endlich wieder einem Konzert beiwohnen zu können.
Es scheint wie eine glückliche Fügung, dass das Klavier-Festival Ruhr mit dem renommierten Beethoven-Spezialisten Rudolf Buchbinder und den „Diabelli Variationen“ sowie mit der deutschen Erstaufführung von elf „Neuen Diabelli Variationen“ in die Saison starten konnte. 1819 hatte der Musikverleger Anton Diabelli an bekannte Komponisten seiner Zeit einen simplen Walzer mit der Bitte um eine Variation geschickt. Johann Nepomuk Hummel, Franz Kalkbrenner, der erst elf Jahre alte Franz Liszt, Franz Schubert und einige andere lieferten. Beethoven ließ sich Zeit, schrieb aber dann gleich 33 „Veränderungen“, die als op. 120 in seinen Werkkanon eingingen. 200 Jahre später fragte Buchbinder mit Blick auf das anstehende Beethoven-Jahr zeitgenössische Komponisten nach neuen Variationen. Elf folgten dem Kompositionsauftrag eines Reigens von europäischen Konzerthäusern, unterstützt von der renommierten Ernst-von-Siemens-Stiftung.

Nicht nur schön, sondern auch wahrlich geräumig: das Anneliese Brost Musikforum Bochum. (Foto: Sven Lorenz)
Elf „Neue Diabelli Variationen“
Frappierend genial wirkt der Walzer aus der Feder des Wiener Musikverlegers nicht. Genial war allerdings Diabellis Marketing-Strategie, das Stück den prominentesten Tonsetzern, Virtuosen und Musikhonoratioren des Kaiserreichs zur Bearbeitung vorzulegen. Leider beginnt das Konzert nicht (wie auf dem Programmzettel angekündigt) mit dem Original-Walzer, sondern gleich mit der ersten neuen Variation „Diabellical Waltz“ der einzigen Komponistin in der Liste, Lera Auerbach. Die Neukompositionen zu Beethovens 250. Geburtstag wirken wie ein globales Stilpanorama. Mit dabei sind der Russe Rodion Schtschedrin, der Australier Brett Dean, der Chinese Tan Dun, der Japaner Toshio Hosokawa, der Brite Max Richter und der Deutsche Jörg Widmann. Ob schräg, witzig oder meditativ – immer ist der kreative Umgang mit Diabellis harmlosem „Schusterfleck“ herauszuhören.
Christian Jost nannte seinen Beitrag schlicht „Rock it, Rudi!“, was sich Rudolf Buchbinder denn auch nicht zweimal sagen ließ. Und zu den amüsantesten zeitgenössischen Beiträgen gehört sicher der von Jörg Widmann: Er scheint sich zu fragen, ob das seltsam zackige Thema Diabellis überhaupt das Zeug zum Walzer hat, erkennt dann eine eklatante Verwandtschaft mit dem Radetzky-Marsch und lässt es zu guter Letzt noch zum Boogie-Woogie mutieren. Andere emotionale und sphärische Klänge erklingen bei Hosokawas „Verlust“. Diese erste Hälfte des Konzertes wird im Klang auch beeinflusst durch den fast leeren Saal. Das Klavierspiel von Rudolf Buchbinder wirkt oft laut und stampfend. Ein nicht allzu fernes Echo scheint die ganze Zeit durch den Raum zu strömen.
Kritische Momente beim „Lebens-Motiv“
Nach einer kurzen Pause beginnt für den Pianisten und die Zuhörer die eigentliche Herausforderung. Hans von Bülow nannte die Diabell-Variationen einmal so knapp wie treffend einen „Mikrokosmos des Beethovenschen Genius, ja, sogar ein Abbild der ganzen Tonwelt“. Beethoven widmete dem einfachen Walzer nicht nur eine Bearbeitung. Er nahm das Thema und versah es mit virtuosen Umspielungen, zerlegte es gnadenlos in seine banalen Einzelteile, aus denen er dann ganz Neues baute, etwa einen pompösen Marsch oder eine dreistimmige Doppelfuge. Diese Welt betritt Buchbinder an diesem Abend mit sehr vehementem Schritt. Töne verschwimmen, die Raffinesse Beethovens will sich nicht einstellen.
Buchbinder, der im Rahmen seines Zweiklangs aus neuer CD-Aufnahme und Buchveröffentlichung sagt, „manchmal habe ich den Eindruck, er sitzt neben mir“ (und damit meint er Ludwig van Beethoven), beschäftigt sich seit vielen Jahren akribisch mit dem Werk Beethovens. Die Diabelli-Variationen, die er bereits zum dritten Mal eingespielt hat, nennt er selber sein „Lebens-Leitmotiv“. Ein Lebensmotiv, das er ohne Zweifel durch die Idee der Neukompositionen bereichert hat, aber der Ursprung wirkt dabei an diesem Abend wenig inspiriert. Kaum Tempovarianten bei raschem Spiel bestimmen den Ablauf der 33 Variationen. Nicht immer gelingen das Austarieren der Crescendi, die homöopathisch dosierten Rubati, die harschen Lautstärke-Kontraste.
Aber sind solche kritischen Momente im Konzert das Entscheidende dieses Abends? Wenn sich am Ende der Variationen das Publikum begeistert zu „Standing Ovations“ erhebt, verspürt man eine erleichterte Freude beim Musiker und seinem Publikum über das gemeinsam Erlebte. Nach monatelanger Stille in den Konzertsälen und sich endlos anfühlendem Warten der Musiker auf den nächsten Auftritt kann man dem Klavier-Festival Ruhr und Rudolf Buchbinder nur Respekt zollen für diesen mutigen Auftakt und den Vorstoß in unbekannte Verhältnisse. Die Kraft der Musik kann letztlich nur im Live-Erlebnis ihren Zauber entfalten. Zugleich darf man aber auch weiterhin gespannt sein, wie sich dieser Zauber in luftig gefüllten Sälen mit Abstandsregeln und Mundschutz in den nächsten Wochen entwickeln wird.
Weitere Konzerte in Dortmund, Düsseldorf, Herten
Das Klavier-Festival Ruhr schaut nach Auftritten von Jan Lisiecki in Dortmund und Essen und einem trotz aller Corona-Beschränkungen stimmungsvollen Konzert mit Anika Vavic auf Schloss Gartrop in Hünxe (Niederrhein) voraus auf den mit Spannung erwarteten Abend mit Igor Levit am 18. Juni im Konzerthaus Dortmund). Weiterhin auf dem Programm: Alexander Krichel (24. Juni, Anneliese Brost Musikforum Ruhr), Olli Mustonen (25. Juni, Gebläsehalle im Landschaftspark Nord, Duisburg) und Kit Armstrong (29. und 30. Juni, Schloss Herten).
Am 1. Juli wird in der Philharmonie Essen der Grandseigneur des Tastenspiels, Sir András Schiff, die enge Verbundenheit Bachs und Beethovens im Kontrapunkt aufzeigen. So finden sich im Programm etwa gleich zwei Werke des Kontrapunktikers Bach, darunter die hochvirtuose „Chromatische Fantasie und Fuge“, deren Echo in der epochalen letzten Klaviersonate Nr. 32 von Beethoven widerhallt. Der Höhepunkt ist dann wohl im Juli der Auftritt von Elisabeth Leonskaja am 6. Juli in Düsseldorf. Auf dem Programm die drei letzten Sonaten op. 109 bis 111, der Gipfel des Beethovenschen Klavierschaffens und eine Hommage an den Wiener Großmeister, die nur schwer vergessen lässt, dass eigentlich das Gesamtwerk Beethovens für Klavier solo in diesem Jahr beim Klavier-Festival Ruhr hätte erklingen sollen.
Über sämtliche Konzerttermine und die aktuellen Programme informiert das Klavier-Festival Ruhr tagesaktuell unter www.klavierfestival.de. Dort finden sich auch Informationen über etwaige neue, die Konzerte des Klavier-Festivals Ruhr betreffende behördliche Verordnungen. Um Karten zu erwerben, trägt man sich am besten online in die Warteliste für das jeweilige Konzert ein.