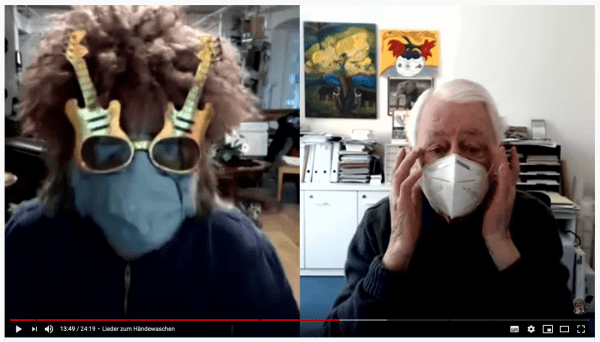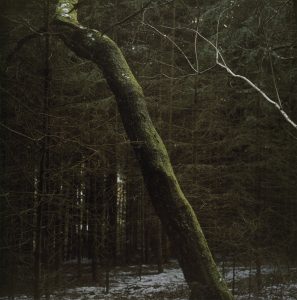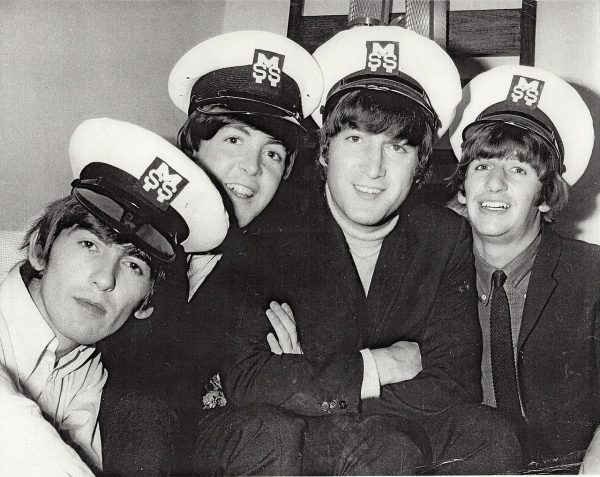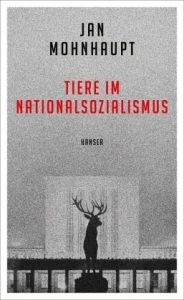Aus ödem Alltag in den Ausnahmezustand: Hilmar Klutes Paris-Roman „Oberkampf“ zwischen Bistros, Kultur, Liebe und Terror
Jonas Becker heißt der Mittvierziger, der sich endlich aus seinem immergleichen Berliner Alltagsleben („Langstreckenglück“) befreien möchte. Er trennt sich von seiner allzeit effizienten Gefährtin Corinna. Auch gibt er die gemeinsame Agentur kluge-koepfe.de auf, die Koryphäen mancher Sorte an Veranstalter vermittelt. Beziehung und Firma liefen eben nicht mehr so gut. Um es bilingual zu sagen: Midlife-Crisis comme il faut.
Wohin kann man gehen, wenn es einem in Berlin zu fad werden sollte? Beispielsweise nach Paris. Immer und immer wieder erfahren wir durch Jonas in Hilmar Klutes Roman „Oberkampf“ (verhärtet klingender Name einer Pariser Métro-Station, benannt nach einem deutschstämmigen Tuchfabrikanten), was wir nicht zu fragen wagten: wie viel eleganter, entspannter, urbaner, kultivierter und sinnlicher die französische Metropole doch sei; wie schon die Sprache jenseits des Rheins sanfter klinge, einem weichen Plumeau vergleichbar. Mehr noch: Zahllose französische Chansons seien wahrhaft dichterisch, ganz anders als die „miefige Sehnsucht der Udo-Jürgens-Lieder“. Auch Schriftsteller haben dort Stil, während sie in Deutschland bestenfalls mal im Hilfiger-Pullover die Lesebühne betreten. Vom wundervollen Essen und von der Liebe ganz zu schweigen. Derlei hat man gelegentlich schon gehört, oder? Oh, là, là!
Ein Bewegungsgesetz dieses ebenso lukullischen wie promillereichen Romans ähnelt dem einiger französischer Kinofilme: Da geht’s unentwegt von Bistro zu Bistro, die Dreh- und Angelpunkte der meisten Tage kreisen ums faire la terrasse und um l’amour. Gleich bei seiner Ankunft gerät jener Jonas an ein munteres, aufgekratztes Trüppchen, das im Dezember einen luftigen Rotwein-Abend zelebriert und über Vorzüge wie Nachteile der Provinz (jemand will nach Montpellier ziehen) frotzelt. Mittendrin: die attraktive Christine, die schon mal in Freiburg studiert hat und leidlich Deutsch spricht. Jonas und sie tauschen keine Adressen, begegnen einander aber später auf wundersame Weise wieder. Wenn das kein Zeichen ist! Daraus erwächst recht rasch ein tägliches Mittagspausen-Ritual: halbe Stunde Liebe machen, halbe Stunde köstlich speisen. Hach ja, c’est Paris, n’est-ce pas?!
Schier endlose Interviews mit einem gealterten Schriftsteller
Weiterer Hauptstrang ist Jonas‘ Job daselbst. Er soll ein ausführliches Buch über den ergrauten Schriftsteller Richard Stein (86) verfassen, der sich in seinem von Fachkreisen hoch geachteten, aber kaum über solche Zirkel hinaus bekannten Werk eigentlich schon genugsam selbst bespiegelt hat. Die schier endlosen Interview-Sitzungen sind denn auch zermürbend. Der nur noch rückwärts blickende Stein verkörpert eine Art von geistiger Dominanz, die seine Mitmenschen zu verschlingen droht. Bloß gut, dass es die lebensdurstig vorwärts drängende Christine als Gegenpol gibt…
Eine Rahmenhandlung, die alles verändert, fasst das gesamte Konstrukt ein, sie hat bestürzend reale Vorbilder. Schon bald nach Beginn des Romans geschieht, sozusagen in Jonas‘ Quartiers-Nachbarschaft, das mörderische Attentat auf die Redaktion des Satireblatts Charlie Hebdo. Es wirkt wie eine Betäubung auf die Hauptstadt. Ganz am Schluss besiegelt ein weiterer Terroranschlag des Jahres 2015 (den wir hier nicht näher bezeichnen wollen, weil er ein frappierendes Ende markiert) die Handlung. Wie war das mit dem Alltag? Nun herrscht Ausnahmezustand in Permanenz.
Übrigens: Jonas ist natürlich eine literarische Figur, dennoch könnte die ihm nachdrücklich zugeschriebene Auffassung irritieren, dass die Leute von Charlie Hebdo ihre Scherze über den Islam eben einfach zu weit getrieben hätten und am Massaker gleichsam selbst schuld oder wenigstens mitschuldig seien. Ein kurzer Trip in die hoffnungslosen Banlieues, den Jonas und Christine hernach unternehmen, deutet jedenfalls auf die Unvereinbarkeit der soziokulturellen Welten in Paris hin.
Klutes Verlag weist derweil auf den zufälligen Umstand hin, dass der Prozess um die Charlie-Attentäter just im September beginnen solle, nahezu zeitgleich mit dem Erscheinen des Romans. Nun ja. Wenn es sich so verhält…
Prägnante Skizzen und weniger produktive Exkurse
Von gewissen Schematismen und dem einen oder anderen Klischee-Ansatz abgesehen, gelingen Hilmar Klute im Verlauf seines Roman etliche prägnante Skizzen von Personen und Situationen. Ein staunenswert mit sich im Reinen scheinender Exil-Wiener namens Altenberg zählt beispielsweise dazu, an einem anderen Ende der Skala auch Frankie, Concierge und Faktotum des Hauses, in dem sich Jonas‘ bescheidene Kleinstwohnung befindet. Und auch Fabian, jener eigentlich eher farblose Ex-Kompagnon aus der Berliner Köpfe-Firma, gewinnt ohne viel Aufhebens literarische Kontur. Die erloschene Liebe zwischen Corinna und Jonas wird in all ihrer Ödnis haarfein dargestellt. Das sind keineswegs nur Fingerübungen, das ist Könnerschaft; nicht so sehr in den ganz großen Bögen, sondern am deutlichsten im Nebenbei. Manche Abfolgen wirken denn auch nicht organisch entwickelt, sondern wie einzeln ersonnen und im Nachhinein montiert.
Hin und wieder verfängt sich Klute in weniger produktiven Exkursen. So müssen etwa, anlässlich eines Friedhofs-Spaziergangs (Montparnasse) mit Christine, an den Gräbern der Berühmtheiten vielerlei Meinungen und Urteile über Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, über Samuel Beckett und Serge Gainsbourg abgearbeitet werden. In einer weiteren Passage passiert Ähnliches mit Böll, Beuys und dem einstigen Literaturpapst Hans Mayer. Auch Max Frisch und Allen Ginsberg werden vergleichend abgehandelt. Zudem erfahren wir einiges über Jonas‘ Buchbestände, die er freilich weitgehend aufgibt. Nach den Aufzählungen kennen wir aber seinen literarischen Kanon. Überhaupt werden viele kulturelle Wertungen vorgenommen, was nicht unbedingt Aufgabe eines Romans ist. Langweilig wird es trotzdem nicht. Wie denn auch – in solchem Ausnahmezustand? Klute beschwört die Dämonen jener Tage auf persönlicher Ebene so herauf, dass es schwerlich ein Entkommen gibt, allenfalls die Illusion des Entrinnens.
Autor und Hauptfigur ließen das Ruhrgebiet weit hinter sich
Halt, das müssen wir jetzt noch nachholen: Hilmar Klute, heute federführender Redakteur der vielgepriesenen „Streiflicht“-Kolumne auf Seite eins der „Süddeutschen Zeitung“, ist gebürtiger Bochumer vom Jahrgang 1967. Doch das Ruhrgebiet hat er – ebenso wie seine Hauptfigur – entschieden hinter sich gelassen. Der Wahl-Berliner hat tatsächlich zwei Jahre in Paris gelebt. Seine Figur Jonas lässt er in Duisburg aufgewachsen sein, beruflich geht’s zuerst nach Köln. Und dann halt auch nach Berlin und Paris. Ein heillos abstruser Abstecher des Romans führt – selbstredend in einem kultigen Cadillac – nach San Francisco und Umgebung. Lauter bedeutsame, inspirierende Zentren also. Jedenfalls theoretisch. Aber egal, wo er ist, der mürrische Held Jonas scheint allerorten einigen Lebensüberdruss mit sich herumzutragen. Kann ihm auf Erden geholfen werden? Gegen Ende hin fühlt er sich auf einmal so seltsam erleichtert und befreit. Dann aber betritt er einen Saal, in dem er schon erwartet wird…
Hilmar Klute: „Oberkampf“. Roman. Galiani Berlin. 320 Seiten. 22 €.
_________________________________________________________
Eine Besprechung von Klutes vorherigem Roman „Was dann nachher so schön fliegt…“ findet sich hier.