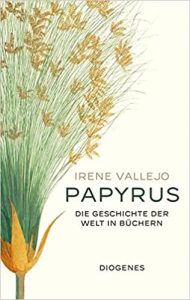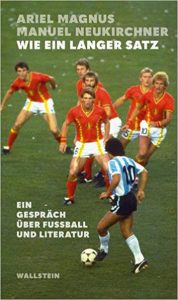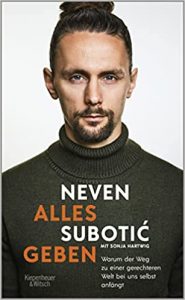Andreas Beckers Bühne für „Galen“ am Theater Münster macht Bedrohung und Zerstörung in der Symbolik des Raumes erfahrbar. (Foto: Oliver Berg)
Nur ein Name steht da: Galen. Kein Titel, keine Beschreibung. Wäre „Der Löwe von Münster“ nicht ein viel attraktiverer Titel gewesen? Aber der Schriftsteller Stefan Moster und der Komponist Thorsten Schmid-Kapfenburg nannten ihre Oper einfach nur „Galen“.
Der Bischof von Münster, entschiedener Gegner der Nazis und ihrer Ideologie, berühmt geworden durch seine Predigten gegen die Euthanasie, sollte als Mensch auf der Bühne auftauchen, nicht als Amtsträger, nicht als Subjekt der Verehrung. Am Theater Münster wurde die Oper uraufgeführt; nach über drei Stunden, die wie im Flug vergehen, bleibt das Auditorium lange Sekunden still, bis der Beifall einsetzt.
Golo Berg, Generalmusikdirektor in Münster und einer der Ideengeber für die Oper, fasst im Interview zusammen, worum es geht: Die Geschichte Clemens August Graf von Galens ist ein lokales Thema, das dennoch große Zusammenhänge herstellt und Konflikte anspricht. Galen musste, allein auf sich und auf seinen Glauben gestellt, zwischen Grundsätzen entscheiden, von denen er jeden für absolut verbindlich hielt. Sich entscheiden zu müssen, unter Umständen persönliche Freiheit und Leben zu riskieren, Ambivalenzen auszuhalten, schmerzlich eigene Grenzen zu spüren: Diese Erfahrung, die der Bischof von Münster in einer extremen historischen Situation machen musste, ist zu allen Zeiten eine existenzielle Herausforderung.

Gegenwart und Vergangenheit begegnen sich: Kathrin Filip als junge Frau von heute und Gregor Dalal als Bischof Galen. (Foto: Oliver Berg)
Dass Galen aktuell geblieben ist, zeigten die Debatten um seine Seligsprechung 2005. Seine „Ecken und Kanten“ werden in der Oper klar thematisiert: Sein striktes national-konservatives Weltbild, geprägt von seiner uradligen Herkunft. Seine Kriegsbegeisterung, als es gegen die gottlosen Bolschewiken ging. Seine unselige, damals theologisch kaum bestrittene Überzeugung, der von Gott eingesetzten Obrigkeit sei Gehorsam geschuldet. Seine anfängliche Sympathie für den „Führer“. Vor allem aber sein heute schwer verständliches Schweigen zur Verfolgung der Juden – und das, obwohl er ein entschiedener Gegner der NS-Rassenideologie war, Papst Pius XII. zur Enzyklika „Mit brennender Sorge“ drängte und in seinen Predigten auf unveräußerliche Menschenrechte Bezug genommen hat. In einer beklemmenden Szene wird Galens Verhalten nach der Pogromnacht thematisiert und erklärt. Der Stachel im Fleisch bleibt dennoch: Der Hut des Rabbiners liegt am Ende groß und einsam in Sven Stratmanns Videoprojektion im Hintergrund der Bühne.
Parabelhaft gesteigerte Charaktere
Die Konzeption der Oper ist eine tragfähige Mischung aus Erzähl-, Dokumentar- und ein wenig Belehrtheater. Holger Potocki arbeitet in seiner Inszenierung sehr sorgfältig an den Charakteren, bricht sie aber auch immer wieder pararabelhaft gesteigert auf. Suzanne McLeod als Galens Mutter etwa verkörpert nicht nur eine steif gekleidete alte adlige Dame, sondern verschmilzt in einer das Surreale streifenden Szene mit der Gottesmutter von Telgte, einem Gnadenbild, das Galen sehr verehrt hat.
Gauleiter Alfred Meyer, einer der Hauptakteure des Holocaust, ist bei Mark Watson Williams nicht nur ein mit gellender Stimme eifernder Zyniker, sondern steht in einer höllengelben Uniform für das Böse, dessen Assistent (Frederik Schauhoff) wie ein Kastenteufel aus dem Untergrund springt. Andere Figuren wie Regens Francken (Mark Coles als alter Weiser), Pfarrer Coppenrath (Stephan Klemm mit heiligem Zorn), Galens Bruder Franz (Youn-Seong Shim) oder Rabbiner Steinthal (anrührend und verzweifelt Enrique Bernardo) sind in den bis ins Detail zeittypischen Kostümen Andreas Beckers dagegen eher einem historischen Realismus zuzuordnen.

Rot, die Farbe der Kardinäle, ist vielfach symbolisch aufgeladen. Für Jasmin (Kathrin Filip) steht sie am Anfang und am Ende ihrer „Zeitreise“ zu Galen. (Foto: Oliver Berg)
Die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart stellt Regisseur Potocki mit einer Videoszene zu Beginn der Oper her: Menschen werden befragt, was sie mit dem Namen „Galen“ verbinden. Eine junge Frau, ahnungslos, lässt sich zum Nachdenken anregen. Man sieht, wie sie auf dem Smartphone die Wikipedia-Seite über Galen aufruft, wie sie Bücher wälzt und schließlich in die Zeit Galens driftet. In den Anblick des (tatsächlich im Westfälischen Museum für religiöse Kultur in Telgte ausgestellten) roten Kardinalsgewands versunken, verlässt die Frau die Gegenwart, „um die Vergangenheit zu verstehen“.
In der Konfrontation der Fragerin von heute – und den Einwänden des Bischofssekretärs (Christian-Kai Sander) von damals – klären sich Galens Positionen, ob für Menschen des 21. Jahrhunderts irritierend zeitbedingt oder beeindruckend zeitlos. Im Libretto ist diese „Jasmin“ genannte junge Frau mit Kopftuch als Muslima angedeutet, verweist auch im Text einmal auf „Allah“. Auf diese Zuspitzung verzichtet die Inszenierung: Die Sängerin Kathrin Filip wirkt wie eine jener Studentinnen, die man in Münster jeden Tag über den Prinzipalmarkt gehen sieht.
Zwischen Befremden und Mitfühlen
Die Ratlosigkeit, das Befremden, die Distanz, aber auch die allmähliche Einsicht, das Verstehen, sogar das Mitfühlen mit den inneren Kämpfen und Entscheidungen des Bischofs macht Filip in sensiblem Spielen deutlich. Am Ende zieht sie ein Resümee: Das rote Kleid des Kardinals als leuchtendes Signal und die Erkenntnis, auch „seine Größe hatte Grenzen“. Vorbilder sind nicht vollkommen, und Helden, die „so sind, wie wir es gerne wären“, die gibt es eben nicht. Galen ist für sie ein „Tröster“, von denen es auf Erden nie genug geben könne. „Tröster leuchten, auch wenn wir sie nicht verstehen.“

Im Volksempfänger hört der Bischof die Rede Alfred Rosenbergs auf dem Markt in Münster. (Foto: Oliver Berg)
Kardinal Galen also als Opernheld: Gregor Dalal hat in dieser großartig ambivalenten Gestalt eine Paraderolle seines reichen Sängerlebens gefunden. Man spürt in jeder Phase, dass sich Dalal intensiv mit der Figur beschäftigt, dass sie ihm ganz und gar entspricht. Er verkörpert den Bischof nicht, er ist Galen in jeder Faser seiner Existenz – vom adligen Jäger des Anfangs über den Priester in Gewissenkonflikten, den entschlossenen Prediger bis hin zu einem erschütterten, gealterten Mann, der die Sieger nicht als Befreier willkommen heißen und die Schuld des deutschen Volkes nicht akzeptieren kann. Auch stimmlich ist Galen eine Paraderolle für den Bassbariton. Man meint, Schmid-Kapfenburg hätte die Rolle genau für diesen Sänger geschrieben.
Wundersame Klanggebilde
Möglicherweise stimmt das auch, denn der Komponist ist seit 2004 Kapellmeister an den Städtischen Bühnen Münster und kennt Dalal seit Jahren. Schmid-Kapfenburg hat bisher viel Kammermusik und eine Kammeroper, aber noch kein großformatiges Werk wie „Galen“ geschrieben. Seiner Partitur merkt man den versierten Kammermusiker und den erfahrenen Dirigenten an. Der Kompositionsschüler von Detlev Glanert schafft wundersame, filigrane Klanggebilde, luzide Klangflächen, kostbare Solo-Stellen für die Orchestermusiker. Auf Tonalität legt er sich nicht fest; so begleitet er die Ausfälligkeiten des Gauleiters ironisch mit den atonalen Klängen, die bei den Nazis als „entartet“ abgestempelt waren. Eine Orgel karikiert dazu musikalisch das Neuheidentum Alfred Rosenbergs, den Bischof Galen als einen der Urheber der menschenverachtenden Rassenideologie von Anfang an bekämpfte.
Schmid-Kapfenburg findet einen Tonfall zwischen dem sachlichen Formbewusstsein eines Paul Hindemith und der angeschrägten Harmonik von Werner Egk, nicht als Sklave eines musikalischen Fortschrittsglaubens, sondern als Schöpfer wirkungsvoll gearbeiteter Theatermusik. Golo Berg ist mit dem Sinfonieorchester Münster ein einfühlsamer Sachwalter, der vor allem für die leisen Töne viel Empathie mitbringt, aber auch heftigen Attacken und Aufschwüngen ihr Recht einräumt. Anton Tremmel hat Chor und Extrachor des Hauses für seine Partie auf und hinter der Bühne solide vorbereitet.
Dem Theater Münster ist für sein Auftragswerk Anerkennung zu zollen: Entstanden ist ein Stück Musiktheater, das eine beeindruckende Person der jüngeren Geschichte mit ihrer Größe und ihren Grenzen und einen profilierten Katholiken in seiner entschlossenen Konsequenz, aber auch all seinen inneren Widersprüchen zu einem Theatererlebnis verdichtet, das als zeitlose Parabel auch über Westfalen hinaus sein Publikum finden dürfte.
Vorstellungen geplant am 4. Juni im Rahmen des Festivals Musica Sacra, sowie am 10., 18., 24. Juni 2022. Info: https://www.theater-muenster.com/produktionen/galen.html, Karten-Tel.: (0251) 59 09 100