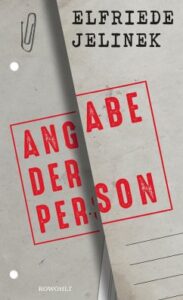Papst Benedikt XVI. ist tot: Kritische Erinnerung an eine prägende Gestalt
Joseph Ratzinger, der emeritierte Papst Benedikt XVI., ist tot. Er starb am heutigen Festtag eines heiligen Papstes, Silvester. Die Gedenkartikel und Nachrufe, für einen 95-Jährigen längst vorbereitet, werden sich in den nächsten Tagen häufen und uns in ein neues Jahr begleiten. Joseph Ratzinger als Denker, als Theologen, als Kirchenmann und als Papst zu würdigen, ist eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Daher nur ein paar wenige, persönliche Gedanken.

Der 2013 zurückgetretene Papst Benedikt XVI., aufgenommen am 10. Juni 2010. (Foto: Mark Bray/Flickr – Creative Commons). Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Natürlich gehörte Joseph Ratzinger für einen theologisch ausgebildeten und lange Jahre kirchlich tätigen Journalisten wie mich zum Alltag: Seine „Einführung in das Christentum“ war Standardlektüre, um seine Stellungnahmen als Konzilstheologe, als Erzbischof von München und Freising, als Präfekt der Glaubenskongregation und als Autor theologischer Werke kam man nicht herum. Sie waren stets bereichernd zu lesen, auch wenn man Dinge anders sah. Die Brillanz seiner Argumentation, die Eleganz der Gedankenführung, die intellektuelle Klarheit und geistliche Verantwortlichkeit, die aus seinen Äußerungen sprach, war stets beeindruckend.
Ob er wirklich „der größte Theologe, der jemals auf dem Stuhl Petri saß“, ob er der „meistgelesene Theologe der Neuzeit“ gewesen ist, mag zu Recht bezweifelt werden. Darüber entscheiden die Perspektiven der Betrachtung – und das Urteil einer Geschichte, die ganz im Sinne Joseph Ratzingers nicht in kurzatmigen Superlativen denkt. Dass er zu den großen Denkern des 20. Jahrhunderts zählt, ist aus einer kirchlichen und europäischen Sicht kaum zu bestreiten. Da tun ihm auch Häme, Spott und eine oft bittere Kritik keinen Abbruch. Ob diese Perspektive in der Sicht einer säkularen (Post-)Moderne und einer polyzentrischen Welt Bestand hat, ist eine andere Frage. Ratzinger war wohl zu sehr Protagonist eines durch und durch europäisch-konservativen Denkens, um auf dem säkularen Areopag mit seiner globalen Stimmenvielfalt so gehört zu werden, wie es seine durchaus weltweit verbreiteten Bewunderer als sicher annehmen.
Umgang mit der „Theologie der Befreiung“
Exemplarisch verdeutlichen könnte das sein Umgang mit der „Theologie der Befreiung“, aus meiner Sicht einer seiner fatalen theologischen und kirchenpolitischen Missgriffe. Er gab der aus dem tiefen Misstrauen gegen den Marxismus und dem Konzept des historischen Materialismus gespeisten Ablehnung Johannes Pauls II. dieser neuen Aufbrüche auf außereuropäischen Kontinenten, namentlich im katholischen Lateinamerika, die intellektuelle Grundlage. Damit begünstigte er – das darf wohl aus der heutigen Perspektive eine Generation später so gesehen werden – den gesellschaftlichen Niedergang des Katholizismus in Lateinamerika, wo heute Synkretismen und evangelikale Sekten obskurster Bekenntnisse mindestens starke Minderheiten bilden.
Joseph Ratzinger, der eigentlich aus seiner bayerischen Heimat ein tiefes Verständnis für die theologisch nicht immer fransenfreie Volksfrömmigkeit mitgebracht haben sollte, konnte die traditionelle Frömmigkeit etwa der Wallfahrer zur Madonna von Guadalupe akzeptieren; die Spiritualität der Basisgemeinden in den Barrios von Managua, den Favelas von Rio de Janeiro oder den von Gewalt erschütterten Elendsvierteln von Cali ist ihm fremd geblieben.
Woran lag das? Wohl nicht an mangelndem gutem Willen, vielleicht nicht einmal an kirchenpolitischen Vorbehalten. Denn Joseph Ratzinger war – anders als gerade in Deutschland gern gemutmaßt – kein gerissener Kirchenpolitiker. Die Ernennungen reaktionärer Gestalten zu Bischöfen, von Dyba (Fulda) über Krenn (St. Pölten) bis Groer (Wien) sind nicht aus seinem Einflussbereich gekommen. Die Ursache sehe ich in seinem Denken: Seine intellektuelle Systemik, das hochästhetische wie gedanklich schlüssige Konstrukt seiner Theologie hatte zu wenig Raum für das störend konkrete Leben in seinen schmutzigen Widersprüchen, für die Empirie und die Erfahrung konkreter Orte, an denen Menschen mit anderen Menschen Gottes- und Welterfahrung machen. Genau darüber aber spricht die Präambel der Konzilskonstitution „Gaudium et Spes“ über die Kirche in der Welt von heute. Zitat:
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die, in Christus geeint, vom Heiligen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet werden und eine Heilsbotschaft empfangen haben, die allen auszurichten ist. Darum erfährt diese Gemeinschaft sich mit der Menschheit und ihrer Geschichte wirklich engstens verbunden.“
Das „Schiff der Kirche“ im Büro
Joseph Ratzinger hat sich auf diese Orte nicht eingelassen. Er hat, soweit ich weiß, die Realität dieser Gemeinden, dieser Kirche an den Rändern etablierter Gesellschaften und unter der Knute des (Neo-)Kolonialismus und eines gnadenlosen, verbrecherischen Kapitalismus nie persönlich kennengelernt. Der Ort seiner Entscheidungen war der Palast der Glaubenskongregation. Dort empfing er wohlwollend und aufgeschlossen Menschen und Berichte. Aber es ist eben ein Unterschied, ob man sich auf dem Deck des Schiffs der Kirche Jesu Christi unmittelbar der Gischt und den Stürmen des Ozeans aussetzt oder ob man in der geschützten Atmosphäre von Büro und Bibliothek verarbeitet, was man von Seegang und Unwetter draußen zu lesen und zu hören bekommt.
Ich erinnere mich genau an die Resignation, die aus den Worten lateinamerikanischer Bischöfe sprach, die vergeblich versucht hatten, den Kardinal Ratzinger zu einem Besuch dort zu bewegen, wo die Erfahrungen für eine Theologie der Befreiung gemacht werden. Ich erinnere mich auch an das Entsetzen, das seine Instruktionen zur Theologie der Befreiung hervorgerufen haben – freilich nicht bei den Bischöfen, die mit den Macht- und Wirtschaftseliten Lateinamerikas paktierten.
Persönliche Begegnungen
Persönlich begegnet bin ich Joseph Ratzinger nur zwei Mal: einmal mit einer kleinen Gruppe von Journalisten im römischen Campo Santo Teutonico und später beim Internationalen Treffen zum Jahr der Jugend 1985 in Rom. Seine Predigt in einem der großen Jugendgottesdienste hat mich damals tief beeindruckt: Er konnte in einfachen, aber brillant präzisen Worten zu den jungen Menschen sprechen und ihnen Jesus Christus nahebringen, ohne sich selbst in den Vordergrund zu spielen.
In meiner Erinnerung bleibt ein freundlicher älterer Herr mit etwas distanziertem Charme und geschliffenen Gedanken, der den „Zeitgeist“ vielleicht etwas zu sehr als Gegner und zu wenig als Chance begriffen hat, der Relationalität und Relativismus zu unscharf trennte und der mit seinem Rücktritt 2013 einen Akt der Demut und der Weisheit setzte. Er möge von den Stürmen der Welt, die ihn so sehr gebeutelt haben, hinweg ins Paradies geführt werden, wo in der Anschauung Gottes alle Grenzen überwunden sind, die gerade ihm, dem Denker, auf Erden schmerzlich bewusst gewesen sein dürften. Sein Anteil sei die Fülle des Lebens, die er nicht müde wurde, in seinem irdischen Wirken als beglückende Perspektive unserer fehlbaren menschlichen Existenz zu verkünden.