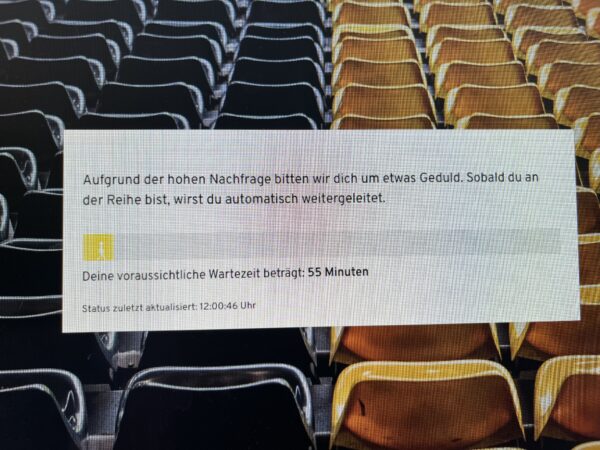Karolin Zeinert vor dem Bayreuther Festspielhaus. (Foto: Werner Häußner)
Die Düsseldorfer Altistin Karolin Zeinert singt mittlerweile in ihrer 11. Spielzeit im Chor der Bayreuther Festspiele. Im Interview erzählt sie, wie sie in Bayreuth ihre professionelle Laufbahn begonnen hat und warum es so faszinierend ist, im Chor der Festspiele mitzuwirken.
Wie hat’s bei Ihnen begonnen mit Bayreuth?
Ich habe immer gerne im Chor gesungen. Mit fünf habe ich damit angefangen, bin dann in meiner Heimatstadt Gera auf ein chororientiertes Gymnasium gegangen und wollte immer Choristin werden. Ich habe dann das Studium begonnen, war nach vier Semestern beim RIAS Kammerchor als Praktikantin und habe festgestellt: Chorsingen ist wirklich meins. Dann habe ich an verschiedenen Theatern Produktionen mitgemacht. Nach dem Abschluss meines Studiums habe ich mich initiativ in Bayreuth beworben. Wagners Musik mochte ich immer, ich habe ja auch am gleichen Tag wie er Geburtstag. Ich habe vorgesungen und ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass es klappt, aber ich wurde genommen und bin nun seit 2012 jedes Jahr bei den Festspielen in Bayreuth. Als ich 2014 an der Deutschen Oper am Rhein ins Festengagement ging, habe ich mir das Okay geholt, dass ich im Sommer nach Bayreuth gehen kann. Mein Chef ist da extrem kulant und die Kollegen haben Verständnis für mich. Das klappt also ganz gut.
Sie sind also bei den Bayreuther Festspielen in Ihre professionelle Laufbahn eingestiegen?

Karolin Zeinert. (Foto: privat)
Ja, tatsächlich. Vorher war ich mal eine Spielzeit in Leipzig, hatte aber sonst immer nur Gastverträge. Ich habe so mein Studium finanziert und Erfahrungen gesammelt. Und nicht zuletzt für mich geklärt, ob ich diesen Job mein Leben lang machen möchte und auch kann. Denn das Singen im Chor ist schon ein spezieller Beruf. Man ist viel unterwegs, soziale Kontakte zu Menschen außerhalb des Theaterbetriebs sind schwierig, und immer, wenn andere frei haben, arbeiten wir. Aber Bayreuth war schon das Highlight für mich. Als ich hier anfing, war ich 26, und lange war ich die jüngste unter den zweiten Altistinnen im Festspielchor.
War Bayreuth neu für Sie? Waren Sie vorher einmal hier?
Weder als Gast noch als Stipendiatin. Die Festspiele waren für mich totales Neuland. Ich kannte auch die Stadt nicht, fühlte mich aber sehr schnell zu Hause. Auch weil ich in Weimar studiert hatte, eine Stadt von ähnlicher Größe und Struktur.
Und wie sind sie mit der Arbeit am Grünen Hügel umgegangen? Hat Sie ein besonderes Bayreuth-Gefühl erfasst?

Die Damen des Bayreuther Festspielchores in Richard Wagners „Der fliegende Holländer“ mit Nadine Weissmann als Mary (links) und Elisabeth Teige als Senta. (Foto: Enrico Nawrath)
Ich erinnere mich, dass ich an einem der ersten Tage einmal an der Hinterbühne vorbeigegangen bin. Die großen Tore waren offen, so dass man von dort in den Zuschauerraum blicken konnte. Ich hatte noch nie in einem Haus mit so vielen Plätzen gesungen und noch nie ein Theater mit so einer tiefen Bühne gesehen. Das war ehrfurchtgebietend, aber ich habe es damals nicht als furchteinflößend erlebt. Erst später, wenn ich jungen Kollegen davon erzählt habe, wurde mir bewusst, was man für Produktionen erlebt hat und mit welchen Sängern man zusammen auf der Bühne gestanden hat. Da habe ich so ein bisschen „das Fürchten gelernt“. Der Premierentag in Bayreuth macht mich immer noch etwas nervös und auch die Vorstellungen sind etwas Besonderes, wenn ich zum Beispiel die kleine Rolle eines Edelknaben im „Tannhäuser“ singe. Da herrscht eine andere Anspannung, weil man es besonders gut machen möchte.
Wie hat sich Ihr Verhältnis zu Wagners Musik entwickelt?
Ich hatte eine Lehrerin in Weimar, die schon recht früh gesagt hat, meine Stimme passe gut ins deutsche Fach und zu Wagner. Daher habe ich mich bald dran versucht und im Studium Erda oder die Wesendonck-Lieder gesungen. Das lag mir gut und passte zu meiner Stimme, weil es viel um die Ausgestaltung von Text geht. So habe ich mich in Wagner reinverliebt. Meine erste Produktion, da war ich Anfang Zwanzig, habe ich in Gera mitgemacht, das war „Tannhäuser“ mit einem Vierzig-Personen-Chor. Das habe ich sehr genossen, und so habe ich mich nach und nach mit den anderen Opern befasst.
Welche ist Ihre Wagner-Lieblingsoper?

Karolin Zeinert im Kostüm – hier für Wagners „Tannhäuser“. Rainer Sellmaier hat die Kostüme für Tobias Kratzers Inszenierung entworfen. (Foto: privat)
Das ist eine fiese Frage, schwierig zu beantworten und von den Umständen abhängig. Beim Bayreuther „Ratten-Lohengrin“ von Hans Neuenfels dachte ich, ja, das ist „meine“ Wagner-Oper. Dann kam der nächste „Lohengrin“, der szenisch anders war und bei dem ich die Längen des Stücks spürte. Ich bin auch eine große Freundin von „Parsifal“, der kann aber auch ewig dauern. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann zwischen „Tannhäuser“ und „Parsifal“. Das Elegische im „Parsifal“ finde ich ganz wunderbar, und das zaubert Pablo Heras-Casado in diesem Jahr wirklich toll. Er lässt das Orchester so leise spielen, dass wir in der Höhe stehen und uns manchmal fragen, ob das Orchester überhaupt noch spielt. Für jemanden, der in Bayreuth debütiert hat und die akustischen Finessen des Hauses noch nicht kennt, hat er die Musik großartig umgesetzt. Er hat auch eine Chorsaalprobe mit uns gemacht und ganz fein gearbeitet. An einem normalen Haus ist gar keine Zeit, so intensiv an Details zu arbeiten. Hier ist es möglich, auszuprobieren, wie weit man ein piano dimmen kann, damit es noch trägt und hörbar bleibt. Das hat großen Spaß gemacht.
Wenn Sie die Arbeit hier mit Düsseldorf oder anderen Theatern vergleichen: Was ist das Spezielle in Bayreuth? Gibt es das?
Ja, das gibt es auf jeden Fall, und zwar unter einigen Aspekten. Zum einen ist der Chor mit 134 Personen hier groß genug. Wir haben zum Beispiel in Düsseldorf auch einen „Fliegenden Holländer“, und da ist es nicht üblich, dass am Abend die Matrosen und der Geisterchor beide live gesungen werden. Die Geister kommen in aller Regel vom Band. Und dabei sind wir in Düsseldorf mit 65 Sängern ein relativ großer Chor – aber hier ist es eben das Doppelte. Hier kommt alles live. Zum anderen konzentriert man sich hier nur auf Wagner. In Düsseldorf haben wir innerhalb einer Spielzeit ein breites Repertoire. Da ist für eine solche Konzentration einfach kein Raum. Es gibt auch nicht so viele musikalische Proben und nicht so viel Zeit, an kleinsten Nuancen zu feilen.
Hier machen wir zehn Wochen lang nichts anderes als Wagner. Wir treffen uns bei „Parsifal“ vor jeder Vorstellung, sogar vor jedem Akt, und singen uns ein. Das heißt, man singt sich zusammen, geht nahe ans Dirigat, lotet noch einmal die Dynamik aus. Man ist hier sehr darauf angewiesen, auf die Chordirigenten zu achten, weil auf der Bühne eine andere Akustik herrscht als im Saal. Wir sind extrem davon abhängig, dass unsere Chordirigenten gut hören und uns perfekt führen. Wir leben hier in der „Glocke Bayreuth“, das ist keine Alltagssituation.
Was nehmen Sie mit aus Bayreuth für Ihre Arbeit an Ihrem Stammhaus? Auch wenn das Niveau der Dirigate unterschiedlich beurteilt wird, arbeiten Sie hier mit verschiedenen musikalischen Charakteren mit unterschiedlichen Auffassungen.
Man nimmt in jedem Fall die unterschiedlichen Weisen des Herangehens an die Musik mit. Wir haben dieses Jahr mit Nathalie Stutzmann im „Tannhäuser“ eine Sängerin als Dirigentin, und es ist interessant, wie ganz anders sie mit der Musik umgeht als Axel Kober, der ja mein Chef in Düsseldorf ist und mit dem wir hier in den letzten Jahren viel Freude hatten. Frau Stutzmann macht viel vor, dirigiert sehr gesanglich, mit viel Bogen und Fläche. Für das Orchester mag das schwierig sein, weil sie wohl weniger akzentuiert. Aber für uns im Chor ist das etwas ganz anderes. Manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, wenn ich zurückkomme und von Bayreuth eine genaue Vorstellung mitbringe, wie bestimmte Stellen zu klingen haben.
Aufschlussreich ist auch zu beobachten, wie unterschiedlich Dirigenten im Umgang mit dem Orchester, dem Ensemble und auch mit Regisseuren sind – und welche Entwicklung sie im Lauf der Zeit machen. Ich erinnere mich an meine ersten Begegnungen mit Christian Thielemann, bei denen ich dachte: Oh, das ist hier aber ein harscher Ton. Einige Jahre später habe ich ihn viel gelöster erlebt. Da wirkte er, als wäre er „angekommen“. Was ich an Bayreuth schätze, ist das Verschwimmen der Distanz zu den „großen“ Sänger-Solisten. Man sitzt in der Kantine, und dann setzt sich ein Georg Zeppenfeld einfach mit an den Tisch. Wenn solche Solisten an einem Haus als Gast kommen und gehen, kommt dieses Miteinander nicht auf.
Wie erleben Sie die Arbeit mit den Regisseuren?
In den letzten elf Jahren habe ich hier – wie auch anderswo – festgestellt: Arbeit und Name gehen nicht immer konform. Es gibt Leute mit großem Ruf, bei denen ich bei der Arbeit die Hände über dem Kopf zusammenschlage und denke, die Ergebnisse sind nur ihrem Team zu verdanken. Und dann gibt es welche, die vielleicht nicht den prominentesten Namen haben, aber genau wissen, was sie wollen und eine tolle Arbeit machen, bei der man sich als Choristin auch mitgenommen fühlt. Die große Herausforderung speziell in Bayreuth ist, dass man den großen Chor auf der Bühne abholt und mitnimmt. Wenn von 134 Leuten jeder am Abend wissen soll, was er zu tun hat, wie seine Rolle und Funktion ist, dann ist das nochmal eine andere Hausnummer als beispielsweise den Chor in Düsseldorf zu führen, der halb so groß ist. Manche Regisseure sind von dieser Menschenmasse einfach eingeschüchtert und vielleicht auch überfordert.
In welchen Inszenierungen haben Sie sich besonders wohl gefühlt?
Die beste Produktion, die ich in den letzten Jahren mitgemacht habe, ist sicherlich der „Tannhäuser“ von Tobias Kratzer. Er kam zur ersten Probe und konnte jeden mit Namen ansprechen! Jeder hat von ihm eine Intention, eine Rolle bekommen, hat genau erfahren, was er wann und wo zu tun hat. Da ist eine solche Truppe dann natürlich voll dabei. Genauso Barrie Kosky. Bei ihm würde ich gerne noch einmal eine Regierarbeit mitmachen, weil mich seine Perfektion beeindruckt hat. Das ist natürlich anstrengend. Im letzten Akt seiner „Meistersinger“ gab es einige „freeze“-Situationen, in denen alle Bewegungen auf Stichwort „einfrieren“ müssen. Das hat er so lange geprobt, bis es 134 Leute plus Statisterie auf den Punkt gemacht haben. Das beeindruckt, nimmt den Chor mit und macht Spaß. Bei Regisseuren, die den Chor eher als Masse oder als Kollektiv betrachten, fühlen sich nicht alle angesprochen. Das ist ein normales Gruppenproblem.
Hat der Bayreuther Festspielchor im Vergleich zu anderen Chören eine eigene Gruppendynamik?
Von den 134 Menschen, die wir in diesem Jahr glücklicherweise wieder sind, sind nicht alle in festen Engagements. Viele arbeiten frei, treffen sich im Sommer hier und haben Bayreuth als Schwerpunkt in ihrem Arbeitsplan. Wer nach Bayreuth kommt, um hier seinen Sommerurlaub zu verbringen, bringt ein spezielles Arbeitsethos mit. Das zeigt sich, wenn der Chor nach einem Jahr wieder zusammenkommt zur ersten Probe. Wir haben die Stücke im Jahr zuvor so minutiös geprobt, dass man das Ergebnis unter den Umständen eines anderen Opernhauses ohne weiteres auf die Bühne stellen könnte. Aber an diesem Punkt beginnt die Arbeit in Bayreuth erst. Da wird an der Intonation gefeilt, da werden Einzelstimmen herausgekitzelt. Das ist anstrengend, aber die Chorsänger, die hier sind, wollen genau das. In einem normalen Opernhaus würde man das zeitlich überhaupt nicht schaffen. Außerdem ist das Klangerlebnis ein ganz anderes. In Düsseldorf haben wir sechs Stellen im zweiten Alt, hier sind es zwölf. Das ist ein ganz anderes Gefühl in der Gruppe. Wenn man da die Augen zumacht, ist der Klang traumschön.
Kann es dieses Erlebnis nicht doch auch anderswo geben?
Ich glaube, das kann man an keinem anderen Haus erreichen. Der Chor ist auch sehr multikulturell, die Sänger kommen von überall her, man trifft so viele Leute, was total schön ist und ein ganz eigenes Gefühl erzeugt. Dann bilden sich Freundschaftsgruppen, die auch Bayreuth überdauern. Man hat eine gemeinsame Leidenschaft, gemeinsame Erinnerungen. Das sind Gründe, warum sich so viele Leute den Sommer um die Ohren schlagen und lange dabei bleiben. Wir feiern regelmäßig 30jährige Jubiläen. Viele sagen: Wenn man einmal in Bayreuth war, dann ist man süchtig danach.