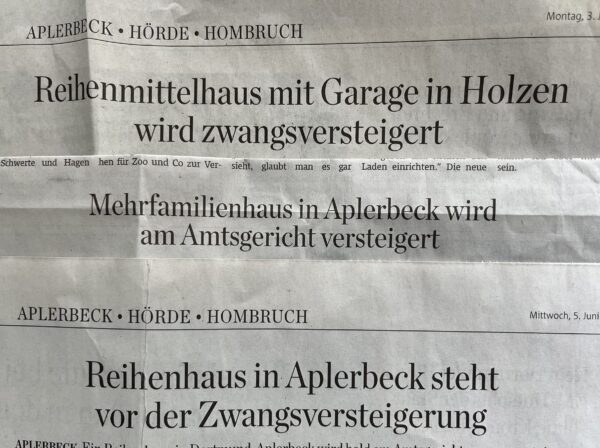Mit allen Sinnen eintauchen: „Kopfüber in die Kunst“

Ferdinand Spindel: Schaumraum, 1969/2024, Ausstellungsansicht aus „Kopfüber in die Kunst“, 2024. (Foto: Roland Baege)
Eines der Zauberworte im Kulturbetrieb lautet seit einigen Jahren so: „immersiv“. Nicht distanzierte, abwägende Kunstbetrachtung ist demnach gefragt, sondern ein spontanes und möglichst tiefes „Eintauchen“ in die Materie, seien es nun musikalische, literarische oder bildnerische Werke. In Dortmund, wo nun Kunst speziell für Kinder und deren Familien aufbereitet wird, sagt man es alltagsnäher: „Kopfüber in die Kunst“, lautet hier die fröhliche Parole. Die „Immersion“ steht im Untertitel.
Stationen der Schau sind acht raumgreifende Environments und Installationen. Solche Arbeiten, durch die man sich bewegen kann, hat das nunmehr 75 Jahre alte Museum Ostwall unter dem damaligen Direktor Eugen Thiemann erstmals gegen Ende der 1960er Jahre gezeigt. Ein Werk von damals, eine rosarote Schaumstoff-Landschaft von Ferdinand Spindel, ist für die jetzige Ausstellung sorgsam rekonstruiert worden. Jetzt dürfen vor allem Kinder die höhlenartige Formation sitzend, liegend, gehend und sonst wie erkunden, sie also aktiv „erobern“. Alles darf dabei berührt werden. Einzige Voraussetzung: Vorher sollen die Schuhe ausgezogen und in bereitgestellten Beuteln verstaut werden.
Wo Kinder das Sagen haben
Den weiteren Parcours darf man dann mit Schuhwerk durchschreiten. Der Rundgang ist ausgesprochen abwechslungsreich. Falls gewünscht, helfen einige Kinder als kundige Erklär-Scouts weiter. Sie haben das Sagen.
Die vielleicht eindrucksvollste Arbeit heißt „Chasing Stars in the Shadow“ (etwa: Sterne im Schatten jagen/fangen, 2022) und stammt vom Koreaner Joon Moon. Buchstäblich wie von Geisterhand bewegen sich virtuelle Figuren, sobald man mit einer kleinen Laterne durch den Raum geht. Obwohl überwiegend Grau in Grau getönt, entfalten sich auf den Wänden, an der Decke und am Boden staunenswert lebendige und überraschend magische Effekte.
In eine ganz anders geartete, ungleich hellere Kunst- und Phantasie-Welt führt die Installation „K. E. S.“ (2024) des dreiköpfigen Künstlerinnen-Kollektivs mit dem hübschen Namen „Frau Hermann“. Ausgehend von kunterbunten Kaleidoskop-Bildern, ergibt sich ein Spielraum mit vielen farbigen Röhrenelementen. Schrecksekunden sind womöglich inbegriffen: Mit der Lizenz zum Berühren habe ich eine dieser Röhren angefasst. Sie fiel sogleich zu Boden und ich fürchtete, ich hätte die Kunst irreparabel beschädigt. Die Künstlerinnen (Claudia Terlunen, Sabine Held, Silvia Liebig) standen freilich lachend daneben: „Gar kein Problem!“ Alles lässt sich kinderleicht wieder neu zusammenfügen. Puh!
Sportstunde im Rathaus
Und so geht es munter weiter – u. a. mit einer filmisch dokumentierten Sportstunde, die Christian Jankowski mit Schülerinnen und Schülern der örtlichen Wilhelm-Röntgen-Realschule im frisch renovierten Ratssaal des Dortmunder Rathauses veranstaltet hat. So bewegt ist es dort wohl noch nie zugegangen. Im selben Zusammenhang dürfen jetzt im Museum Hula-Hoop-Reifen erprobt werden – eine Aktion, zu der sich Jankowski in New York inspirieren ließ. Die schwingenden architektonischen Kreisbewegungen des berühmten Guggenheim Museums werden gleichsam nebenbei nachempfunden. So jedenfalls meint es der Künstler.
Jenseits des Alltäglichen
Schnell zeigt sich in der Praxis, dass Kinder tatsächlich unbefangener mit den Aktions-Angeboten solcher Kunst umgehen. Erwachsene können hier allerdings gut und gerne „das Kind in sich“ wiederentdecken. Und es gibt ja auch Arbeiten, die just eher die erwachsenen Gäste ansprechen dürften, beispielsweise das „Environnement Chromointerférent Translucide C“ (1974/2009) von Carlos Cruz-Diez, der auch schon 1968 im Museum Ostwall eine damals neuartige Installation gezeigt hat. Die verblüffenden Effekte beruhen auf wandelbaren Farbinterferenzen, welche durch Projektion auf lichtdurchlässige Leinwände zustande kommen. Da geht man durch eine unwirklich flirrende und verspiegelte Welt, in der sich alles Körperhafte aufzulösen scheint. Eine sinnliche Erfahrung jenseits des Alltäglichen.
August Macke und Fragen zum Zoo
Schließlich hat auch der „Masterstudiengang Szenographie und Kommunikation“ (so etwas gibt’s) der Fachhochschule Dortmund eine Installation erstellt. „un/fenced“ (etwa: un/eingezäunt) bezieht sich auf ein Hauptwerk der Dortmunder Kunstsammlungen, August Mackes Gemälde „Großer Zoologischer Garten“ von 1913, in dem sich Menschen und Tiere sozusagen gleichberechtigt begegnen. Angeregt von kritischen Fragen zur Zoohaltung, sind vor allem monumentale Rundsäulen mit nachgeahmten Tierhäuten (Leopard, Elefant, Schlange etc.) entstanden, denen sich durch Berührung entsprechende Laute entlocken lassen. Nur eine nette Spielerei oder erste Schritte zum anderen Umgang mit Natur?
„Kopfüber in die Kunst. Vom Environment zur Immersion“. Eine Ausstellung für Familien. Museum Ostwall im Dortmunder U, Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 Dortmund. Noch bis zum 25. August 2024. Geöffnet Di, Mi, Sa, So und an Feiertagen 11-18 Uhr, Do/Fr 11-20 Uhr.
www.dortmunder-u.de/museum-ostwall/
___________________________________
Der Beitrag ist zuerst im Kulturmagazin „Westfalenspiegel“ erschienen: www.westfalenspiegel.de





 Messer und Gabel für alle
Messer und Gabel für alle