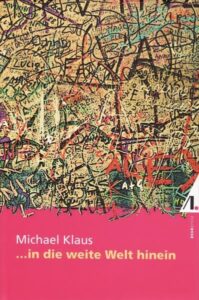Ruin der menschlichen Beziehungen – Johan Simons inszeniert O`Neills „Eines langen Tages Reise in die Nacht“ in Bochum

Szene mit (v.l.) Alexander Wertmann, Pierre Bokma und Guy Clemens. (Foto: Armin Smailovic/Schauspielhaus Bochum)
Am Eingang wird das Publikum gewarnt. Laut werde es, aber nur am Anfang, kostenlose Ohrenstöpsel gibt’s am Stand mit den Programmen. Auf der Bühne dann, der eiserne Vorhang hat sich gehoben, ein weißes Haus mit Fenstern, Tür und Inneneinrichtung. Das steht da einfach so, minutenlang, während aus dem Off ein betörend schönes, langsames Blechbläsersolo ertönt.
Kommt gleich Till Brönner um die Ecke? Nein, aber völlig unvermittelt kracht das Häuslein ohrenbetäubend zusammen, und die Stöpsel, die man für die schöne Musik aus den Ohren gezogen hatte, haben einem überhaupt nichts genutzt.
Ein Haus stürzt ein
Der stimmige Simonsche Knalleffekt nimmt vorweg, was in den folgenden drei Stunden intensiv herausgespielt wird: Das Haus als zentraler Ort familiärer Geborgenheit, Sicherheit und Struktur ist ein Trümmerhaufen schon, bevor das Spiel beginnt. Intendant Johan Simons inszeniert im Schauspielhaus Bochum Eugene O’Neills Stück „Eines langen Tages Reise in die Nacht“ als bedrückendes Tableau menschlicher Unzulänglichkeiten. Und warum es nicht hier schon sagen: Ein großartiger Theaterabend ist es geworden, getragen von Akteuren, denen die Berufsbezeichnung Schauspielkünstler (ein bedeutender Vertreter der Kritikerzunft verwendete sie besonders gerne) angemessen ist.

Elsie de Brauw als Mutter Mary (Foto: Armin Smailovic/Schauspielhaus Bochum)
Eine Künstlerin
Allen voran ist die Künstlerin zu nennen, Elsie de Brauw, die sich als morphiumsüchtige Mutter Mary in mitunter atemberaubende schauspielerische Intensität steigert, eins wird mit ihrer Rolle, wie man es in Inszenierungen der letzten Jahre kaum noch gesehen hat. Ein bißchen holländische Grundierung hört man bei ihr noch heraus, doch hat sie ihr Deutsch – so jedenfalls schein es dem Verfasser dieser Zeilen – in den letzten Jahren perfektioniert. Die holländische Sprachfärbung wirkt, so könnte man vielleicht sagen, wie ein leichter V-Effekt und tut der Erzählung gut. Außerdem agiert die zierliche Schauspielerin (Jahrgang 1960) mit einer Körperlichkeit, die man eher von einer Zwanzigjährigen erwarten würde. Man kann es nicht anders sagen: dieser Theaterabend ist ihr Abend, ein Erlebnis.

Szene mit (v.l.) Alexander Wertmann, Pierre Bokma und Konstantin Bühler. (Foto: Armin Smailovic/Schauspielhaus Bochum)
Der Patriarch
Ein weiterer hoch zu preisender Akteur ist Pierre Bokma als ihr Mann, ein gleichermaßen brummeliger, düsterer, geiziger wie auch wichtigtuerischer und protziger Patriarch, ein Vater, auf den man sich nicht verlassen, auf den man nicht hoffen kann. Bokma ist eine kongeniale Besetzung für die Rolle des alten Schauspielers James Tyrone.
Die Familie hat Probleme
Ein bißchen Inhalt will noch erzählt werden, denn Inhalt gibt es schon, Handlung eher nicht. Die Familie des einstigen Bühnenstars James Tyrone – er, sein Frau Mary sowie die Söhne Jamie und Edmund – verbringen ihren Sommer im nebelumwaberten Ferienhaus am Ozean. Quasi sachliche Probleme sind die Morphiumsucht der Mutter, die nach der schweren Geburt des jüngeren Sohnes entstand, der Alkoholismus der drei Herren, die Schwindsucht Edmunds, die lieblose Entscheidung des Alten, ihn für mindestens ein halbes Jahr in eine öffentliche (statt private) Therapieeinrichtung zu stecken, um Geld zu sparen. Doch das alles wäre ja, wenn nicht lösbar, so doch besprechbar oder therapierbar.
Nicht mehr zu reparieren
Nicht zu reparieren aber ist der Totalruin der zwischenmenschlichen Beziehungen. Das vergiftete, lustvoll-zwanghaft betriebene Spiel mit Nähe und Distanz, Liebe und Destruktion, Verzeihen und Entwertung (und so weiter und so weiter) prägt den langen Tag. Die Eltern spielen es, und natürlich hat es die Kinder kaputtgemacht, und etwas Besonderes ist es gleich gar nicht. Jeder im Zuschauerraum kennt solche Familienverhältnisse, bei sich selbst, bei anderen. Und die Bühne kennt sie natürlich auch. Auch von vielen anderen Autoren.

Szene mit (v.l.) Guy Clemens und Pierre Bokma (Foto: Armin Smailovic/Schauspielhaus Bochum)
Die anderen
Bleibt die weiteren Mitwirkenden zu preisen, die sämtlich stark in ihren Rollen auftreten. Guy Clemens ist der ältere Bruder Jamie, dem das Stück eine in ihrer Ambivalenz geradezu bedrohliche Haß-/Liebeserklärung für seinen jüngeren Bruder Edmund (Alexander Wertmann) zugeteilt hat, furios und alkoholisch enthemmt gespielt. Der junge Edmund wiederum steigert sich beeindruckend im Streit mit seinem Vater, der ihn in die Billigklinik abschieben will. Konstantin Bühler als Diener (im Original ist übrigens ein Hausmädchen vorgesehen) und Django Gantz als von Mutter Mary im Morphiumrausch fast verführter Handwerker komplettieren die Besetzung.
Ein Sittenbild
Zum Ende des Stücks hin werden Selbsterklärungen verbindlicher, Zwiegespräche länger und intensiver, entsteht Raum für eine tragische Verständnisebene. Johan Simon, der einen respektvollen Umgang mit der Vorlage pflegt, zeigt uns diese Entwicklung, legt aber gleichzeitig viel Gewicht auf die Anmutung eines eher stillstehenden Sittenbildes. Die Verhältnisse sind, wie sie sind. Und auch wenn alle unter ihnen leiden, werden sie nicht besser werden. Doch lange sah man diese Unzulänglichkeit nicht mehr so grandios auf die Bühne gestellt wie in dieser Inszenierung.
Einige Jahre, ist zu lesen, wird uns Altmeister Johan Simon (er ist jetzt 78) noch in Bochum erhalten bleiben, bis sein Nachfolger Nicolas Stemann 2027 antritt. Man darf gespannt sein, was er in dieser Zeit realisieren wird, mit seiner wunderbaren Art, „richtige“ Stücke mit viel Text und Spieldauer zu realisieren.
Großer Applaus.
- Weitere Aufführungen
- 11.Oktober
- 30. Oktober
www.schauspielhausbochum.de