Aufklärung, das unvollendete Projekt – opulente Ausstellung in Berlin

Erstdruck der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika vom 4. Juli 1776, gedruckt von Steiner und Cist in deutscher Sprache, Philadelphia, 8. Juli 1776. (© Deutsches Historisches Museum)
In einem der wirkungsmächtigsten Dokumente der demokratischen Staatsphilosophie, formuliert im Jahr 1776, wird festgestellt, „daß alle Menschen gleich erschaffen worden, daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freyheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Daß zur Versicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt worden sind, welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten; daß sobald einige Regierungsform diesen Endzwecken verderblich wird, es das Recht des Volks ist, sie zu verändern oder abzuschaffen, und eine neue Regierung einzusetzen, die auf solche Grundsätze gegründet, und deren Macht und Gewalt solchergestalt gebildet wird, als ihnen zur Erhaltung ihrer Sicherheit und Glückseligkeit am schicklichsten zu seyn dünket.“
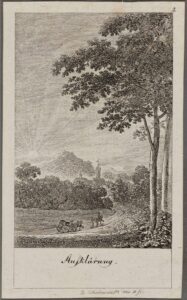
Daniel Chodowiecki: Allegorisches Blatt zum Zeitalter der Aufklärung, Göttingen, 1791. (© Deutsches Historisches Museum)
Hauptautor der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die sofort vom in Philadelphia angesiedelten Druckhaus „Steiner und Cist“ ins Deutsche übersetzt wurde, war Thomas Jefferson, ein von der Aufklärung geprägter Staatstheoretiker, der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aller Menschen predigte (und der Französischen Revolution die passenden Stichwörter lieferte) und im Sinne von Immanuel Kant die Vernunft als oberste Maxime des menschlichen Denkens und Handels propagierte.
Jefferson war auch Sklavenhalter
Jefferson war aber auch, und das wird gern vergessen, ein reicher Großgrundbesitzer, der auf seinen Plantagen hunderte Sklaven für sich schuften und sich darüber keine grauen Haare wachsen ließ. Wer die richtigen Ideen formuliert und die Fortschrittsgeschichte der Demokratie beflügelt, muss also im konkreten Handeln und alltäglichen Leben nicht immer ein leuchtendes Vorbild und schon gar nicht unbedingt ein guter Mensch sein.
Deutlich wird das jetzt wieder in einer mit über 400 Exponaten opulent ausgestatteten Ausstellung im Deutschen Historischen Museum Berlin (DHM). Sie trägt den Titel: „Was ist Aufklärung? Fragen an das 18. Jahrhundert“ und kreist längst nicht nur um das Denken von Kant, der in einem berühmten Aufsatz von 1784 die Frage, was denn eigentlich Aufklärung sei, in der „Berlinischen Monatsschrift“ auf die Vernunft als kategorischen Imperativ verwies und schrieb: „Habe Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“

Friedrich Wilhelm Springer: Miniaturbildnis des Immanuel Kant, Königsberg, 1795 (© Deutsches Historisches Museum)
Der Aufsatz von Kant ist genauso als historisches Dokument ersten Ranges in der grandiosen Ausstellung dokumentiert, wie auch der Erstdruck der deutschen Übersetzung der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung sowie das Original des handgeschrieben Verzeichnisses mit den Namen der von Thomas Jefferson ausgebeuteten Sklaven.
Zwiespältige Vernunft
Die Aufklärung, lernen wir, ist ein von Widersprüchen gezeichnetes Unterfangen, eine Aufgabe, die bis heute nicht vollendet ist. Zum Ende der mit Bilder-Fluten und Text-Bergen, Video-Installationen und Hör-Stationen zur ambivalenten Geschichte der Aufklärung und der mit politischen Verweisen und wissenschaftlichen Exkursen fast überinszenierten Performance zur Kulturgeschichte eines widerborstigen Begriffs erinnern uns denn auch Theodor W. Adorno und Max Horkheimer an die „Dialektik der Aufklärung“ und ihre Warnung, dass der aufklärerische, vernunftgeleitete Zweck der Selbstbefreiung zum bloßen Instrument verkommen könne, um alle möglichen Zwecke zu erreichen.

„Große Scheiben-Elektrisiermaschine“ aus dem Besitz Johann Wolfgang von Goethes. (© Klassik Stiftung Weimar, Museen)
Von Kant bis Habermas
Das letzte Wort hat dann Jürgen Habermas, der wohl bedeutendste Soziologe und Philosoph der Gegenwart: Er beschwört trotz aller Krisen, Kriege und Katastrophen der Moderne die „Einsicht der klassischen Aufklärung: Deren rationaler Kern besteht unverändert darin, an die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger zu appellieren, ihre Vernunft öffentlich zu gebrauchen, um politisch auf die Gestaltung der Grundlagen ihrer gesellschaftlichen Existenz Einfluss zu nehmen. Eine solche vernünftige politische Willensbildung ist freilich nur im Rahmen der Institutionen eines unversehrten demokratischen Rechtsstaates und auf der Basis einer wenigstens halbwegs gerechten Gesellschaft möglich.“
Um anschaulich zu machen, wie weit der Weg von Kant bis Habermas war, werden Fragen zu Wissenschaft und Geschichte gestellt, Bilder, Skulpturen und Dokumente gezeigt, die den Fortschritt des Menschenbildes und das Unbehagen an der Kultur belegen, Geschlechterrollen befragen, über Bedeutung von Religion und Pädagogik nachdenken und die Aufklärung als unvollendetes Projekt der Menschheitsgeschichte beschreibt.

Georg Melchior Kraus: „Zwischen Wissenschaft und Ehe“, Mainz, um 1770-1776. (© Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg)
„Was ist Aufklärung? Fragen an das 18. Jahrhundert“, Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, 10117 Berlin, Pei-Bau, 1. und 2. OG. Bis 6. April 2025, geöffnet täglich 10-18 Uhr (geschlossen nur am 24.12.2024), Eintritt 7 Euro, ermäßigt 3,50 Euro, bis 18 Jahre frei. Infos unter www.dhm.de/aufklaerung, Katalog (Hirmer Verlag) im Museum 30 Euro, im Buchhandel 39,90 Euro.