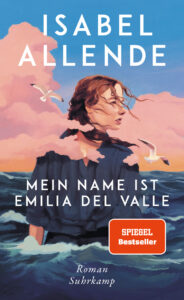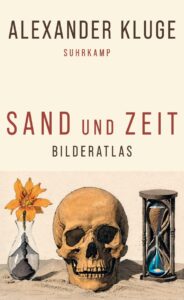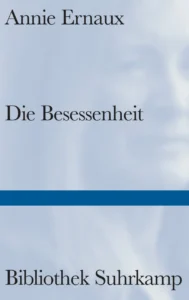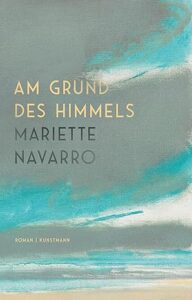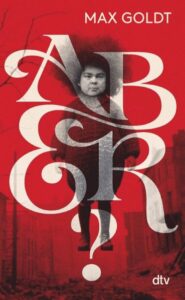Groteske Sozialkritik im Asia-Restaurant: In Hagen startet eine neue Intendanz mit Peter Eötvös‘ „Der Goldene Drache“

Spielfreudiges Ensemble (von links): Nike Tiecke, Anton Kuzenok, Angela Davis, Kenneth Mattice, Ks. Richard van Gemert. (Foto: Leszek Januszewski)
Abschied und Neubeginn: Mit dem ehrgeizigen Projekt einer Uraufführung hat Intendant Francis Hüsers in Hagen noch einmal für einen Höhepunkt gesorgt. Auch sein Nachfolger Søren Schuhmacher bekennt sich zum Musiktheater der Gegenwart.
„American Mother“, die Oper der amerikanischen Komponistin Charlotte Bray, einfühlsam inszeniert von Travis Preston und vom Orchester unter dem ebenfalls scheidenden GMD Joseph Trafton auf makellosem Niveau gespielt, setzte einen tief bewegenden Schlusspunkt unter Hüsers achtjährige Intendanz.
Schuhmacher wird sich am 4. Oktober mit einem Klassiker, Verdis „La Traviata“, als Regisseur vorstellen. Seine auf fünf Jahre angelegte Intendanz eröffnet er jedoch mit Zeitgenössischem: „Der goldene Drache“ des im letzten Jahr verstorbenen Peter Eötvös stellt zugleich das neue Format „CloseUP!“ vor: Das Publikum darf auf die Bühne, sitzt auf drei Seiten um eine zentrale Spielfläche. Die vierte Seite, zum offenen Bühnenportal und dem leeren Zuschauerraum hin, besetzen die sechzehn Musiker des Orchesters.
Seit der Uraufführung 2014 in Frankfurt wird „Der goldene Drache“ häufig gespielt. Das liegt sicher auch an der perfekten Machart der Vorlage, einem Schauspiel von Roland Schimmelpfennig, das 2010 zum „Stück des Jahres“ gekürt wurde. Die Story dreht sich um einen jungen, illegal in einem Schnellrestaurant arbeitenden Chinesen mit wahnsinnigen Zahnschmerzen. Da er nicht zum Zahnarzt gehen kann, reißen ihm die Kollegen den kariösen Zahn mit einer Rohrzange. Der „Kleine“ verblutet; sein Leichnam wird in einen Fluss geworfen.
Lakonisches Erzählen und surreale Komödiantik
Wie Schimmelpfennig verbindet Eötvös sozialkritischen Realismus mit grotesken Zügen, verwebt in das Drama des „Kleinen“ die alte Fabel von der Grille und der Ameise. Sie wird zum schockierenden Gleichnis ausbeuterischer Abhängigkeit und sexuellen Missbrauchs. Kennzeichnend für die stark gekürzten Textfassung, die Eötvös in Absprache mit Schimmelpfennig für sein Musiktheater erstellt hat, ist das Ineinandergreifen von lakonischem Erzählen und surrealer Komödiantik, die einmünden in eine fantastische Übersteigerung am Ende, wenn der „Kleine“ als Toter übers Meer nach Hause schwimmt.
Der Monolog des toten jungen Chinesen ist das einzige ariose Innehalten in den gut 90 Minuten und sprengt die Erzählebenen. Wenn zuletzt der gezogene Zahn in einen Fluss gespuckt wird, erinnert die absurde Szene nicht nur an den von Eötvös geschätzten Samuel Beckett, sondern reißt einen transzendenten Horizont auf: Der junge Mensch und sein Zahn sind im Fließen des Wassers wieder vereint. „Der Zahn ist weg, als ob er nie dagewesen wäre“, ist der letzte Satz des Stücks.
Zwischen leichtfüßigem Boulevard und verstörender Intensität
In ihrer Inszenierung in Hagen bricht Julia Huebner den Strang des Erzählens auf, gibt den realistisch anmutenden Abschnitten in der beengten Küche des Asia-Restaurants einen verfremdenden Touch von überzogenem Boulevard, setzt die Fabel-Szenen der Grille durch eine Gondel und Live-Videos auf Distanz, lässt sie dadurch gleichzeitig verstörend eindringlich wirken.
Das Spiel der fünf Hagener Ensemblemitglieder, die in achtzehn Rollen schlüpfen, hat Züge des Impro-Theaters und wirkt leichtfüßig und überzogen, als käme es von der Bretterbühne eines Jahrmarkts. Die Kostümwechsel auf offener Szene (punktgenau karg von Iris Holstein) unterstreichen die Distanz vom naturalistischen Spiel und heben die Extreme und Kontraste hervor, auf die Eötvös abgezielt hat.
Mit der Musik von Peter Eötvös demonstrieren die Hagener Musikerinnen und Musiker, wie vertraut sie mittlerweile mit dem Idiom zeitgenössischer Klänge und Strukturen sind. Steffen Müller-Gabriel spornt an, wo es um rhythmische Pointen oder Klangakzente geht, dämpft aber ab, wo untergründiges Flüstern, dünnwandige Tongebilde und verhaltene Akkorde gefragt sind. Eötvös‘ setzt nicht auf Schärfe und Überwältigung, aber auch nicht auf süffiges Illustrieren. Er nimmt Anleihen bei Kabarett- und Operettenmusik, lässt dem Sprachrhythmus und dem verständlichen Wort stets den Vortritt. Wenn sich die Leichtigkeit verdichtet, bilden sich magisch schillernde Blasen luftigen Klangs.

Angela Davis in „Der Goldene Drache“, u.a. als Ameise. (Foto: Leszek Januszewski)
Das Hagener Ensemble mit Angela Davis, Anton Kuzenok, Richard van Gemert, Kenneth Mattice und der leichtstimmigen, ursprünglich aus dem Musical kommenden Sopranistin Nike Tiecke als „Kleinen“ findet die Balance zwischen Disziplin und Momenten grotesker Übertreibung. Ein gelungener Start in die neue Spielzeit, der hoffen lässt, dass Schuhmacher das bisherige Niveau in Hagen hält und durch neue Akzente bereichert.
Info: https://www.theaterhagen.de/veranstaltung/der-goldene-drache-1926/0/show/Play/