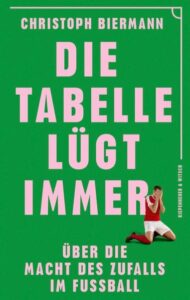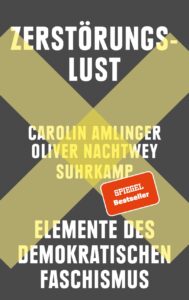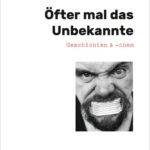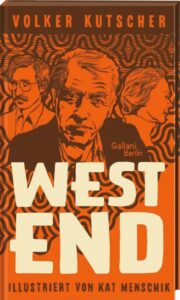Zauber des Zufalls: Christoph Biermanns erhellendes Fußballbuch „Die Tabelle lügt immer“
Was hat Christoph Biermann, gewiss einer unserer besten Fußballexperten, da im Sinn: Will er diesen Sport vollends entmystifizieren? Sollen wir denn nicht mehr in den üblichen, im Sog der Medien und Netzwerke abschnurrenden Narrativen übers Kicken reden? Nun, jedenfalls hält Biermann hartnäckig dafür, das Leistungsniveau der Fußballteams von den Resultaten zu trennen und endlich die gewichtige Rolle des Zufalls anzuerkennen.
Es gebe, so Biermann, eigentlich keine Torschüsse, in denen nicht das Rauschen des Zufalls vernehmbar sei. Kein Schuss sei zu 100 Prozent wiederholbar, somit sei auch das Ergebnis nicht vorhersehbar – und wenn man noch so viel Technik zur Spielanalyse einsetzt. Das sekundengenaue Tracking, die „Datafizierung“ des Fußballs, beispielsweise die Berechnung der „expected goals“, all das könne letztlich vieles nicht schlüssig erklären, z. B. Paco Alcacers Torflut beim BVB und seine anschließende Ladehemmung bei anderen Clubs. Und und und.
Der Buchtitel klingt steil: „Die Tabelle lügt immer“. Gerade der allzeit mitregierende Zufall bringt seinerseits Mythen hervor und sorgt immer wieder für Überraschungen; nicht nur, wenn die „eigenen Gesetze“ des Pokals beschworen werden, denen zufolge unterklassige Teams Spitzenmannschaften besiegen können. Eine „faire“, den Leistungen entsprechende Tabelle, so heißt es, komme im Ligabetrieb laut Wahrscheinlichkeits-Rechnung jeweils erst nach 19 Spielzeiten zustande. Warum, möchte man da sogleich fragen, werden dann fast immer die Bayern Meister? Tja. Wahrscheinlich Zufall, oder? Oder eben der notorische Bayerndusel alias das „Glück der Tüchtigen“?
Schon die geringe Anzahl der Tore beim Fußball (z. B. im Vergleich zum Basketball) mache ihn anfällig für Zufälle, befindet Biermann. Ein einziger Fehl- oder Glücksschuss könne ein ganzes Spiel entscheiden, von unfassbaren Torwartparaden (gängige Redensart: „Er hat auch die Unhaltbaren gehalten“) mal ganz abgesehen.
Von Stochastik und Matrix ist da die Rede, von aleatorischer und epistemischer Unsicherheit beim Kalkulieren der Chancen. Nicht-Mathematikern schwirrt da vielleicht der Kopf, altgediente Fußballfans mögen abgehobene „Spinnerei“ wittern, doch Biermann zieht unbeirrbar seine Argumenations-Schleifen, führt ungemein viele konkrete Belege an und vergisst dabei wohl kaum ein Phänomen auf dem grünen Rasen.
All diese Unwägbarkeiten: rätselhafte „Fehleinkäufe“, Verletzungen, Formschwankungen, mieses Mannschaftsklima, fatale Fehlgriffe des Trainerstabs, sodann Spieler und Teams, die plötzlich „über sich hinauswachsen“ oder unversehens kläglich versagen, sogenannte „Angstgegner“ und irrwitzige „Kacktore“, Glück und Pech bei Elfmetern, Latte, Pfosten, das wechselhafte Wirken der Schiedsrichter und der Leute im VAR-Keller, zumal bei Abseits, Foul- und Handspiel usw. Fazit: Eine unfehlbare Erfolgsformel gibt es im Fußball nicht, von der Hoffnung auf „gerechte“ oder dem Zorn über „unverdiente“ Ergebnisse müssen wir uns verabschieden.
Schließlich gilt (allen klugen Erwägungen zum Trotz) mal wieder die unverwüstliche Dortmunder Weisheit von Adi Preisler: „Grau is‘ alle Theorie, entscheidend is‘ auf’m Platz“. Und dort waltet – neben Können oder Unvermögen – eben auch der Zauber des Zufalls.
Christoph Biermann: „Die Tabelle lügt immer. Über die Macht des Zufalls im Fußball“. Kiepenheuer & Witsch, 286 Seiten, 18 Euro.