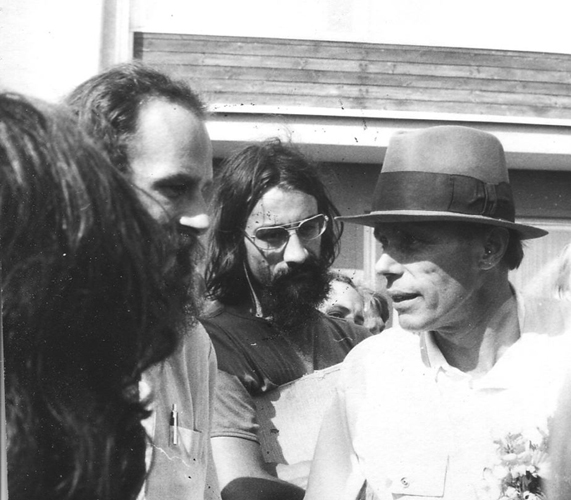Reisen durch ein fantastisches Universum: Vor 100 Jahren wurde Stanislaw Lem geboren
Als Science-Fiction-Autor wollte er sich nicht gerne bezeichnen lassen, aber auf diesem Feld hat sich Stanislaw Lem einen unsterblichen Namen gemacht. Vor 100 Jahren, am 12. September 1921, im damals noch polnischen Lemberg geboren, hat er originelle Werke voll Humor und visionärer Kraft geschrieben, die laut Wikipedia in 57 Sprachen übersetzt und über 45 Millionen Mal verkauft wurden.

Die Werke von Stanislaw Lem erscheinen im Suhrkamp-Verlag, so auch der Roman „Die Stimme des Herrn“. (Cover: Suhrkamp Verlag)
Zu seinen bekanntesten Büchern zählt der Roman „Solaris“, der drei Mal verfilmt und von Michael Obst, Detlev Glanert und Dai Fujikura auch zum Opernstoff erkoren wurde. Stanislaw Lem hatte gerade begonnen, Medizin zu studieren, als die Deutschen in Lemberg einmarschierten. Während des Krieges gelingt es ihm, seine jüdische Herkunft zu verschleiern; er arbeitet als Mechaniker und Schweißer für eine deutsche Firma. Bis auf Vater und Mutter wurde seine Familie Opfer des Holocausts. Wehrmacht und Rote Armee, Sowjets und Deutsche: Die Erfahrung willkürlicher Gewalt und der zerstörerischen Katastrophe der Besatzungszeit in Polen prägten ihn.
1946 zieht er aus seiner nun sowjetisch besetzten Heimat nach Krakau und studiert weiter. Da er sich weigert, im Abschlussexamen Antworten im Sinne der stalinistischen Ideologie zu geben, fällt er durch und geht, da er nicht als Arzt arbeiten kann, in die Forschung.
In dieser Zeit beginnt seine schriftstellerische Arbeit. 1946 erscheint in einer Zeitschrift „Der Mensch vom Mars“. Lem spricht darin bereits Themen an, die in späteren Werken bedeutsam werden sollten: Das Wesen vom Mars ist eine Kombination aus einem organischen Gehirn und einer atomgetriebenen Maschine, ungeheuer fremdartig, ohne Gefühl und Empathie, aber nicht bösartig. Die Menschen, die es untersuchen, haben jedoch kein Interesse an der Persönlichkeit des Außerirdischen; es gelingt ihnen keine dauerhafte Kontaktaufnahme.
Unbegreiflich andersartige Intelligenz
Diese Unfähigkeit, mit unbegreiflich andersartigem Leben, mit unverständlicher Intelligenz umzugehen, ist auch in „Solaris“ ein bestimmendes Thema. Dort umfließt ein riesiges Wesen wie ein Ozean einen ganzen Planeten. Ewig alleine, versucht es, mit den Menschen in Kontakt zu treten, die es entdeckt haben und die seit Generationen versuchen, das offenbar denkende Plasmameer zu erforschen. Lem verweigert sich in diesem wie in anderen Romanen einfachen Lösungen, aber die offen bleibende, dennoch sehr bewegende Begegnung des Psychologen Kelvin mit dem Wesen deutet den utopischen Moment eines Kontakts an.
Mit dem in viele Sprachen übersetzten Roman „Die Astronauten“ gelingt Lem 1951 ein Erfolg, der es ihm ermöglicht, als freischaffender Autor zu leben. Das Buch erschien drei Jahre später in der DDR auf Deutsch als „Der Planet des Todes“. Eine Expedition zur Venus entdeckt dort die Reste einer aggressiven Zivilisation, die sich selbst vernichtet hat, bevor sie ihren Plan, alles Leben auf der Erde auszulöschen, in die Tat umsetzen konnte. „Wesen […], die sich die Vernichtung anderer zum Ziel setzten, tragen den Keim des eigenen Verderbens in sich – und wenn sie noch so mächtig sind“, schreibt Lem über sein Buch, das er später selbst als „naiv“ bezeichnet hat.
Nachdenken über technologischen Fortschritt
Aber die gesellschaftlichen Probleme und Visionen, die Lem auch in Romanen wie „Eden“ (1959) oder dem Zukunfts-Szenario „Fiasko“ (1986) in fantastische Welten überträgt, fesseln den Leser und lassen über die Folgen unseres zivilisatorischen und technischen Fortschritts nachdenken. Lem nimmt schon früh etwa mögliche Folgen neuer Kommunikationstechnologien in den Blick. Über die Epoche der Neuro- und Gentechnologie und die Verbindung von Mensch und Maschine sagt er in einem Interview kurz vor seinem Tod 2006: „Wir stehen am Anfang einer Epoche, vor der mir ein bisschen graut.“
Stanislaw Lem hat es virtuos verstanden, ungewöhnliche philosophische Fragen, Probleme der technologischen Entwicklung und kühne Gedankenexperimente in seine Art von „Science Fiction“ einzubeziehen. Doch er ist auch Autor von geradezu prophetischer Sachliteratur wie der „Dialoge“ (1957) oder der „Summa technologiae“ von 1964, in der er sich bereits mit „virtual reality“ und Nanotechnik beschäftigt.
Zwischen 1982 und 1988 lebt Lem nicht im krisengeschüttelten Polen, sondern als hochgeachteter Autor in Berlin und Wien. Seine Kurzgeschichten, Anthologien und Romane finden in den siebziger und achtziger Jahren in beiden Teilen Deutschlands breite Resonanz, so etwa die „Robotermärchen“, der „Futurologische Kongress“ oder „Der Unbesiegbare“. Figuren wie der Raumfahrer Ijon Tichy, der Pilot Pirx oder die beiden skurrilen Robot-Konstrukteure Trurl und Klapaucius bevölkern sein Universum, in dem Humor und Satire nicht zu kurz kommen, aber auch – wie in der Erzählung „Terminus“ – bisweilen eine kaum zu fassende, unheimliche Atmosphäre entsteht, die Lem selbst so beschreibt: „Obwohl in dieser Erzählung keine Gespenster vorkommen, sind sie dennoch da.“
Persönliche Empfehlungen? Unheimlich und faszinierend zugleich, wie in „Der Unbesiegbare“ unscheinbare, harmlose Maschinenteilchen zu einer unüberwindlichen Macht zusammenwachsen. Höchst amüsant und geistreich, wie in den „Robotermärchen“ ein Elektrodrachen besiegt wird. Wen heute bei „Alexa“ oder „Siri“ im smart durchdigitalisierten Home leises Unbehagen befällt, sollte unbedingt mit der dümmsten vernunftbegabten Waschmaschine der Welt Bekanntschaft schließen. Immer wieder ins Nachdenken führend, wie fremdartig Lem außerirdisches (intelligentes) Leben erfindet und beschreibt, etwa in „Solaris“. Und eine bittere Abrechnung mit der menschlichen Fähigkeit zum Guten wie zum Bösen ist „Die Stimme des Herrn“, spröde zu lesen, aber ein Buch, das den Verstand fliegen lässt.