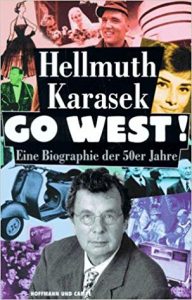„Mit Normen lässt sich Sprache nicht lenken“ – Gespräch mit Martin Walser, nicht nur über die Rechtschreibreform
Von Bernd Berke
Dortmund. Mit seinem Roman „Finks Krieg“ hat Martin Walser (69) tiefen Einblick ins Innenleben eines Ministerialbeamten gegeben, der im Zuge eines Regierungswechsels auf einen minderen Posten abgeschoben wird. Dieser Fink, einer wirklichen Person nachgebildet, aber literarisch zur Kenntlichkeit gebracht, wird zum angstgepeinigten Kämpfer für sein Recht. Walser stellte das bei Suhrkamp erschienene Buch jetzt mit einer Lesung im Dortmunder Harenberg City-Center vor. Dort traf ihn die Westfälische Rundschau zum Gespräch.
Sie haben die vor wenigen Tagen publizierte „Frankfurter Erklärung“ mitunterzeichnet, einen entschiedenen Protest vieler Autoren gegen die Rechtschreibreform. Kommt das nicht zu spät?
Martin Walser: Ich hatte immer mein Leid mit dem Duden und mußte mich immer gegen Lektoren durchsetzen, die unter Duden-Diktat meine Manuskripte korrigiert haben. Mit nachlassender Energie habe ich immer auf meinen Schreibungen beharrt.
Nennen Sie uns ein Beispiel?
Walser: Mein Paradebeispiel ist „eine Zeitlang“. Ich hab‘ stets „eine Zeit lang“ in zwei Wörtern geschrieben. Der Duden verlangt es in einem Wort, was ja völlig unsinnig ist. Es stimmt weder historisch noch rational. Nach der neuen Rechtschreibung dürfte ich’s auseinander schreiben. Das ist für mich ein Fortschritt. Nur: Es ist eine autoritär ausgestattete Reform. Sie behebt einige Idiotien und installiert dafür andere. „Rau“ ohne „h“, da möcht‘ ich mal wissen, wer sich das ausgedacht hat…
Und wieso erheben Sie erst jetzt Einspruch?
Walser: Nun, weil Friedrich Denk (Deutschlehrer und Literatur-Veranstalter in Weilheim, d. Red.), der die Sache angeregt hat, mich jetzt befragt hat. Ich selbst hätte gedacht: Na, schön. Das ist gut, das ist blödsinnig – und hätte es dabei belassen. Weil ich sowieso nicht praktiziere, was im Duden steht. Schauen Sie: In meinem Roman „Brandung“ steht die Wortfolge „zusammenstürzender Kristallpalast“. Das müßte ich in Zukunft auseinander schreiben: „zusammen stürzender“.
Eine Sinnverfälschung?
Walser: So ist es. Hoffentlich sehen die Leute nun, daß solche Sprachnormen relativ sind. Vielleicht bildet sich gerade dann ein bißchen mehr Freiheit gegenüber den Regeln. Denn Sprache ist doch Natur – und sie ist Geschichte. Beides läßt sich nicht mit Normen lenken. Ich schreibe ja mit der Hand, folge einem rein akustischen Diktat in meinem Kopf. Wenn ich das nachher lese: Das ist so unorthographisch, so grotesk. Wenn ich Ihnen das zeigen würde, würden Sie sagen: „Das ist ein Analphabet.“ V und F geht da durcheinander wie „Fogel und Visch“. Schreibend ist man eben nicht auf Duden-Niveau.
Mal abgesehen von der Rechtschreib-Debatte: Ansonsten hat sich – Stichwort: Deutsche Einheit, die Sie früh und vehement befürwortet haben – die Aufregung um Sie ein wenig gelegt.
Walser: Zum Glück. Aber ich krieg‘ immer noch genug ab. Ein Rezensent hat geschrieben, er höre in „Finks Krieg“, in der politischen Tendenz „Marschmusik“. Seit der Diskussion um die Einheit haben die mich in diese Richtung geschickt, diese Arschlöcher! Der Peter Glotz empfindet in meinem Roman „dumpf-deutsche Fieberphantasien“. Ein anderer hat sinngemäß geschrieben: „Der Walser hat sich vom linken Kämpfer zum CSU-Festredner der deutschen Einheit entwickelt.“ Und das in einer Buchbesprechung.
Worte, die sich in Sie hineinfressen?
Walser: Ja, ja, ja. Ich wandere geistig aus d i e s e r Art von Gesellschaft aus. Ich will damit nichts zu tun haben, mit diesen Einteilungen – links, rechts. Mein Hausspruch lautet: „Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr.“ In mir hat mehr als eine Meinung Platz. Ich hab‘ in den 70er Jahren erfahren, wie die Konservativen mit mir umgegangen sind. Damals hieß es: „Du bist ein Kommunist.“ Jetzt weiß ich, wie die Linken mit Andersdenkenden umgehen. Es ist noch verletzender. Und ich meine nach wie vor: Das größte politische Glück, das die Deutschen in diesem Jahrhundert hatten, ist diese Einheit. Die Misere steht auf einem anderen Blatt, aber sie hat Aussicht auf Behebung. Die Misere vorher war aussichtslos.
Und „Finks Krieg“, ist das der Roman über unsere politische Klasse?
Walser: Für mich ist es der Roman über einen leidenden Menschen. Übrigens war die Vorarbeit sehr quälend. Ich habe zwei volle Jahre Material studiert. Furchtbar. Immer nur notieren ist entsetzlich. Ein unguter Zwang. Ich bin auch nicht ganz gesund geblieben dabei. Ich habe manchmal gedacht: Vielleicht hört es überhaupt nicht mehr auf, vielleicht wirst du nie Herr des Verfahrens, vielleicht bist du nie imstande, frei zu schreiben. Mein neues Projekt hat deswegen gar nichts mehr mit Quellen und Recherchen zu tun. Es wird ein Buch über meine Kindheit – so, wie sie mir heute vorkommen möchte.