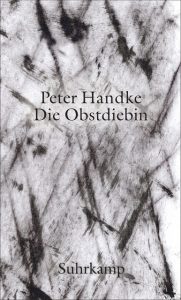Jede Menge Licht: Der Dortmunder Filmemacher Adolf Winkelmann wird 75

Adolf Winkelmann vor dem „Dortmunder U“, auf dem seine Film-Installationen laufen. (Foto: Roland Gorecki / Dortmund Agentur)
Sagen wir mal so: Adolf Winkelmann war so klug und weitsichtig, praktisch zeitlebens in Dortmund zu bleiben. In Städten wie Berlin oder Hamburg hätte er sich anfangs wohl gegen viele durchsetzen müssen, hier aber ist er sozusagen gleich singulär hervorgetreten und hat zeitig etwas gegolten. Von hier aus, in der „unaufgeregtesten Großstadt der Republik“ (wie die „Zeit“ mal schrieb), konnte er nach und nach bundesweit bekannt werden. Noch dazu dürfte sein Hiersein stets eine Herzensangelegenheit gewesen sein.
Von nichts kommt nichts: Der Mann, der an diesem Samstag (10. April) 75 Jahre alt wird, verfügt – ganz gleich, an welchem Ort – natürlich über technische und kreative Begabungen, die längst reiche Früchte getragen haben und zu großen Verdiensten angewachsen sind. Dortmunds Kulturdezernent Jörg Stüdemann würdigt ihn so: „Adolf Winkelmann ist ein herausragender Filmemacher, Ausbilder und als Künstler ein Glücksfall für Dortmund“, kurzum: „einer unserer wichtigsten Kulturbotschafter“. Wohl wahr. Wer, wenn nicht er? Wo doch andere große Söhne der Stadt – Peter Rühmkorf, Martin Kippenberger, Norbert Tadeusz usw. – anderswo ihren Weg gemacht haben.
Mit „Die Abfahrer“ (1978) und „Jede Menge Kohle“ (1981) hat Adolf Winkelmann sozusagen d i e authentischen Ruhrgebietsfilme jener Jahre gedreht, gleichermaßen komödiantisch wie präzise und zeitgemäß in der sozialen Beschreibungskraft. Gewiss keine Glorifizierung der Gegend, aber doch Liebe zur Region und ihren Menschen mitsamt allen Brüchen und Verwerfungen. Auch heute noch, beim Wiedersehen, haben diese frühen Filme Bestand. Das Kultpotenzial ist unverwüstlich, legendär zudem das Repertoire an schnoddrig-coolen Haltungen und Sprüchen Marke Revier, allen voran der Klassiker: „Es kommt der Tag, da will die Säge sägen.“
Es folgten kaum minder prägnante Streifen wie „Super“ (1984), „Peng! Du bist tot!“ (1987), „Der Leibwächter“ (1989) und das um den Revierfußball kreisende Werk „Nordkurve“ (1993). 2016 reichte Winkelmann mit der Romanverfilmung „Junges Licht“ (Vorlage von Ralf Rothmann) einen weiteren, alsbald ebenfalls preisgekrönten Ruhrgebietsfilm nach, der im Dortmund der 1960er Jahre spielt und höchst eindringlich die Kinder- und Jugendjahre eines Bergarbeitersohnes schildert. Wenn man so will, ist es eine Vorgeschichte zu den „Abfahrern“ und zu „Jede Menge Kohle“. Und es ist ein grandioser Heimatfilm der ganz anderen Art, der sich einfach „richtig“ anfühlt. Zwischendurch kam – neben etlichen anderen Produktionen – die bewegende und bestürzende Pharma-Skandalchronik „Contergan“ (ARD-Zweiteiler, 2007) heraus.
Mehrfach erhielt der Regisseur den Deutschen Filmpreis, auch der Grimmepreis blieb kein Einzelstück. Aber wir wollen nicht alle Trophäen aufzählen und nur noch kurz erwähnen, dass er 2003 zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Filmakademie gehörte.
Wenn man sich noch einmal vor Augen führt, welche Darsteller(innen) in Winkelmanns Filmen zu sehen waren, so weiß man, dass er mit seinem soliden Können und seinen Stoffen einige der Besten überzeugt hat. Die Skala reicht – um nur wenige Beispiele zu nennen – von Hermann Lause und Martin Lüttge über Günter Lamprecht und Gottfried John bis zu Matthias Brandt, August Zirner und Peter Fitz. Sogar in Nebenrollen (!) traten Größen wie Hannelore Hoger und Ulrich Wildgruber auf. Und selbstverständlich hatte die unvergessene Tana Schanzara mehrmals einen Ehrenplatz im Winkelmann-Kosmos.
Über alle Kinofilme hinaus, hat Winkelmann in Dortmund ein weithin sichtbares Zeichen seines Wirkens setzen können: Zum Ruhrgebiets-Kulturhauptstadtjahr 2010 entwarf er – als Krönung fürs „Dortmunder U“ – die „Fliegenden Bilder“, eine bei Tag und Nacht aufleuchtende Film-Installation hoch droben auf der ehemaligen Brauerei. Seine Arbeit steigert die Aura des ohnehin schon imposanten Dortmunder Wahrzeichens. Inzwischen gehören 150 Filme zum Bestand, darunter Szenen mit meterhohen Tauben (quasi die Wappentiere des einstigen Reviers), schwarzgelber Kickerseligkeit oder schäumendem Bier, doch auch Kreationen, die über regionale Befindlichkeiten hinausweisen. Außerdem gibt es zuweilen tagesaktuelle Bezüge. Um all das fortzuführen, nahm die nicht gerade übermäßig reiche Stadt richtig Geld in die Hände: Ende 2020 wurden die mit rund 6000 LEDs ausgestatteten Lamellen ersetzt und die Technik wurde runderneuert. Kostenpunkt dafür: 2,6 Millionen Euro. Aber wer will da kleinlich sein? So gut wie alle Auto-, Rad-, Bahn- oder Busfahrenden und alle Passantinnen, die seit 2010 in der Dortmunder Innenstadt aufgekreuzt sind, kennen diese Schöpfung aus Licht.
Soeben neu erschienen ist Adolf Winkelmanns Buch „Die Bilder, der Boschmann und ich“ im Bottroper Verlag Henselowsky Boschmann (176 Seiten, 14,90 Euro): Im Gespräch mit dem Verleger Werner Boschmann erzählt Adolf Winkelmann über sein Leben und seine Kunst; eine ausführliche Retrospektive und eine längst nicht nur anekdotische Einführung ins Werk, an der man künftig schwerlich vorbeikommen wird.
Wer darauf wetten sollte, dass Winkelmann gebürtiger Dortmunder sein muss, hätte verloren. Der Filmemacher ist zwar durch und durch von dieser Stadt geprägt, er wurde aber am 10. April 1946 im sauerländischen Hallenberg am Rand des Rothaargebirges geboren. Als er etwa drei Jahre alt war, zogen seine Eltern in die größte Stadt Westfalens: Adolf Winkelmann wuchs in unmittelbarer Nähe zur Dortmunder Union-Brauerei (Jahrzehnte später just das „Dortmunder U“) auf, machte sein Abitur am hiesigen Helmholtz-Gymnasium und studierte von 1965 bis 1968 an der damaligen Werkkunstschule Kassel. Dort muss ihn das Heimweh ergriffen haben, denn danach zog er wieder nach Dortmund und blieb der Stadt treu. Hier hat er rund 40 Jahre lang als Professor für Film-Design an der Fachhochschule gelehrt und dabei Generationen von Filmschaffenden in Feinheiten des Metiers eingeweiht.
Die Stadt Dortmund erinnert in einer Geburtstags-Würdigung an Winkelmanns ersten Experimentalfilm, der vor fast 54 Jahren in Kassel entstanden ist und der da lakonisch heißt: „Adolf Winkelmann, 9.12.1967 11 h 54″. Der Filmemacher, damals 21 Jahre jung, habe größere Irritationen ausgelöst, als er sich beim Spaziergang selbst filmte. Sollte er damit gar das Selfie miterfunden haben?